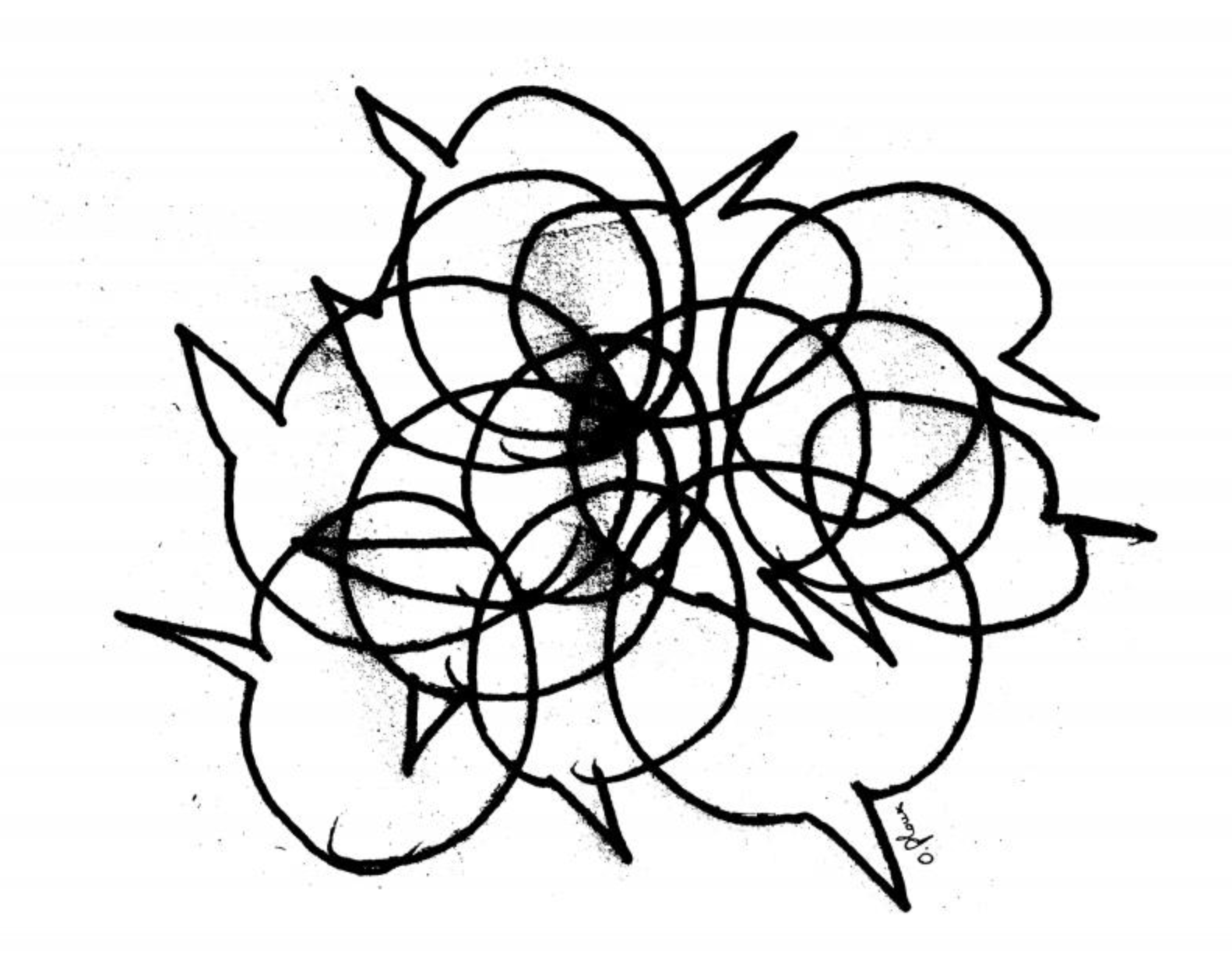Während Belgien und Frankreich bei Redaktionsschluss noch immer nach einer Regierung suchen, was dadurch erschwert wird, rechtsextreme Parteien auszuschließen, haben manche ihrer Nachbarn den Schritt bereits gewagt und radikale rechte Gruppierungen in ihre Regierungen aufgenommen.
„Mit Finnland, Italien und der Slowakei haben sich zwei weitere EU-Länder angeschlossen, deren Regierungen extremistische Parteien präsentieren, die bis vor kurzem noch geächtet waren“, schreibt Petr Jedlička in Deník Referendum. In Kroatien „haben wir bereits die dritte Regierung in Folge, die von der traditionellen rechtsnationalen, aber pro-westlichen Partei HDZ angeführt wird, in die zum ersten Mal jedoch die rechtsextreme Patriotische Bewegung (MP) eintritt”, so Jedlička weiter.
In den Niederlanden dauerte es 223 Tage, bis am 2. Juli die Regierung unter der Führung des ehemaligen Geheimdienstchefs Dick Schoofs gebildet wurde. Obwohl er keiner Partei angehörte, führt er seitdem die am weitesten rechts stehende Regierung in der jüngeren Geschichte des Landes an, wie Politico feststellt. Die Anfangszeit war von Spannungen zwischen den Koalitionsparteien geprägt, betont Dieuwertje Kuipers in Vrij Nederland, insbesondere aufgrund der Kritik von Geert Wilders an seinen Partnern. Der Vorsitzende der rechtsextremen Partei für die Freiheit (PVV), die bei den Parlamentswahlen 2023 als stärkste Kraft hervorgehen ist, hatte aufgrund seiner unverschämten Äußerungen für Unbehagen gesorgt.
Wilders nutzt die Freiheit, die ihm sein „einfaches“ Abgeordnetenmandat gibt, und erweckt den unangenehmen Eindruck, Schoofs und der gesamten Koalition über X (ex-Twitter) seine Ansichten aufzuzwingen. Es ist daher nicht verwunderlich, so Kuipers weiter, dass „viele Wähler damit rechnen, dass die Exekutive aufgrund dieser unterschiedlichen Positionen vorzeitig auseinanderbrechen wird.”
Es ist sicher kein Zufall, dass Wilders ausgerechnet das kontroverseste soziale Netzwerk auswählt, um die Regierung zu spalten: Seit der Übernahme durch den südafrikanisch-amerikanischen Magnaten Elon Musk vor zwei Jahren hat sich die Plattform in eine Arena verwandelt, in der Hassreden und Verschwörungstheorien sowie rechtsextreme Bots ihren Platz haben. „X wurde einst als 'planetarer öffentlicher Platz' beschrieben, auf dem Journalisten, Politiker und interessierte Bürger zusammenkommen konnten, um öffentlich zu diskutieren. Doch angesichts der vielen linksgerichteten Journalisten, Akademiker und User, die X verlassen haben, scheint es unwahrscheinlich, dass die Plattform wieder zu dem wird, was sie einmal war“, bedauert Katherine M. FitzGerald in The Conversation.
Im Namen der ungehinderten Meinungsfreiheit hat der Besitzer von Tesla und SpaceX Persönlichkeiten wieder aufgenommen oder befördert, die von der vorherigen Regierung verbannt worden waren, und er zögert nicht, gegen die Nutzungsregeln der Plattform zu verstoßen, indem er falsche Informationen und Deepfakes - von künstlicher Intelligenz erstellte Videos, in denen echte Persönlichkeiten vorkommen - teilt. Wenn der reichste Mann der Welt das größte digitale Megafon in die Hand nimmt, hat dies für alle Bereiche der Gesellschaft weitreichende Konsequenzen.
Das haben wir diesen Sommer wieder einmal gesehen, als in mehreren Städten Großbritanniens Krawalle ausgebrochen sind, die sich gegen Migranten richteten. Grund dafür war ein Attentat, bei dem drei Kinder in einem Tanzkurs in Southport (Nordwestengland) erstochen wurden - angeblich von einem muslimischen Asylbewerber. Da zählte am Ende nicht, dass der mutmaßliche Täter ein britischer Staatsbürger ist, der als Sohn ruandischer Eltern geboren wurde. Die Gerüchte, verstärkt durch „Influencer“ wie Stephen Yaxley-Lennon (besser bekannt als Tommy Robinson) oder Andrew Tate waren stärker als die Wahrheit.
Die beiden Influencer wurden von Musk aus der Verbannung geholt, der noch dazu Öl ins Feuer goss, indem er versicherte, dass „ein Bürgerkrieg in Großbritannien unvermeidlich“ sei, woraufhin er von Alan Rusbridger in der britischen Tageszeitung The Independent als „Pyromane mit einer Streichholzschachtel in der Hand“ bezeichnet wurde. Der Chefredakteur von Prospect kritisiert in seinem Magazin „die Art und Weise, wie Twitter/X gehandhabt wird - oder auch nicht“ und „wie die Plattform benutzt wird, um Hass zu schüren, wenn nicht sogar sehr reale Gewalt. Zudem, so Prospect „mache sie es unvorstellbar, dass manche Dinge wahr und überprüfbar sind und andere nicht.”
„In diesem Sommer haben wir etwas noch nie Dagewesenes erlebt“, stellt Carole Cadwalladr in The Guardian fest: „Der Milliardär [Musk] legte sich öffentlich mit einem gewählten Spitzenpolitiker [Premierminister Keir Starmer] an und nutzte seine Plattform, um dessen Autorität zu untergraben und zu Gewalt aufzurufen. Die Unruhen im Sommer 2024 in England waren Elon Musks Testballon „für die US-Präsidentschaftswahlen im November.” Doch „kam er ungeschoren davon“, fügt die Expertin für Rechtsextremismus und soziale Netzwerke hinzu. „Wenn Sie nicht erschrocken sind über die außergewöhnliche supranationale Macht, die das darstellt, und über die möglichen Folgen, sollten Sie es sein!”
Zumal sich diese Plattformen offenbar immer mehr von Regeln befreien und ihre Gründer ungehemmte Selbstregulierung predigen: „Twitter, jetzt X, hat mindestens die Hälfte seines Teams, das für Transparenz und Sicherheit zuständig ist, entlassen. [...] Tausende von Mitarbeitern, die mit der Aufdeckung von Falschmeldungen betraut waren, wurden von Meta, TikTok, Snap und Discord entlassen [und] Facebook hat eines seiner letzten Transparenz-Tools, CrowdTangle eingestellt.”
Angesichts dieser Tatsachen ist die Reaktion der Behörden in Europa gelinde gesagt schwach und sie offenbart das ungleiche Kräfteverhältnis zwischen staatlichen Behörden und digitalen Plattformen. Letzten Monat schickte der EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen, Thierry Breton, einen Brief an Elon Musk, um ihn daran zu erinnern, dass er als Chef von X nach europäischem Recht die Verpflichtung habe, die Verbreitung schädlicher Inhalte zu verhindern. Daraufhin antwortete der reichste Mann der Welt mit einem Meme, dessen Tonfall sein Konzept der Meinungsfreiheit und seine Vision einer globalen Agora veranschaulicht. Das sagt einiges.
Während X vor allem den Interessen der extremen Rechten zu dienen scheint, scheint Telegram zwar politisch neutraler, aber nicht weniger toxisch zu sein. Der kürzlich in Paris verhaftete Mitbegründer Pawel Durow hat sich nämlich, so weit bekannt, stets geweigert, sich in die Blockierung von Konten einzumischen, die auf seinem Messenger gehostet werden. Telegram hat zwar in Ländern, in denen die Pressefreiheit von den Behörden angegriffen wird, allen voran Russland, eine Alternative zum Internet geboten, ist aber bei Kreml-Befürwortern aller Couleur ebenso beliebt wie bei russischen Oppositionellen.
Dass zwei Parteien, die einander den Krieg erklärt haben, ohne Vermittler die gleiche Plattform für ihre Kommunikation nutzen, „spiegelt Durows Vorstellung von Meinungsfreiheit wider“, erklären Andrej Soldatow und Irina Borogan, die für CEPA arbeiten: „Laut Durow soll sich jeder in den sozialen Medien ohne Kontrolle seitens der Regierung ausdrücken können.” Seine „fast anarchische Haltung scheint an die Ideologie der frühen Hackerbewegung der 1980er-Jahre anzuknüpfen, aber das ist heute, wo doch Regierungen auf der ganzen Welt gegen den libertären Ansatz des Internets angehen, keine praktikable Strategie mehr“, meinen die beiden russischen Exiljournalisten. Denn „niemand - außer vielleicht die Technologiegiganten selbst - kann bestreiten, dass unregulierte soziale Netzwerke offensichtlich viel Schaden anrichten können. Die Zeit der unmoderierten sozialen Medien ist schon lange vorbei.“
„Ist staatlicher Zwang der einzige Weg, um die Einhaltung der Regeln durchzusetzen?“, fragen Soldatov und Borogan weiter und geben darauf selbst die Antwort: „Die sozialen Medien sind ein wesentlicher Bestandteil unseres gesellschaftlichen Gefüges, und unsere Gesellschaft ist durchaus in der Lage, über Nichtregierungsorganisationen oder Parlamente und parlamentarische Anhörungen Kontrollmechanismen zu schaffen, die keine Verhaftung von CEOs wegen mangelnder Mäßigung beinhalten.”
In Zusammenarbeit mit Display Europe, kofinanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind jedoch ausschließlich die des Autors/der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die der Europäischen Union oder der Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologie wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können für sie verantwortlich gemacht werden.

Schätzen Sie unsere Arbeit?
Dann helfen Sie uns, multilingualen europäischen Journalismus weiterhin frei zugänglich anbieten zu können. Ihre einmalige oder monatliche Spende garantiert die Unabhängigkeit unserer Redaktion. Danke!