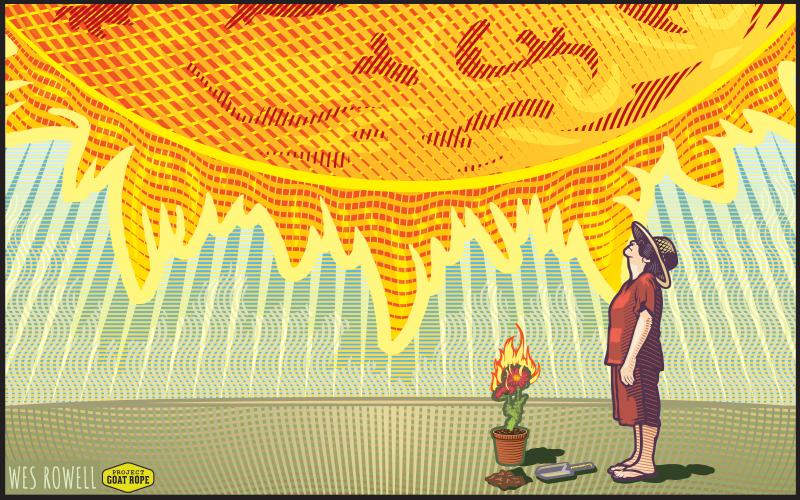Behauptung: Anfang 2024 erklärte der niederländische Europaabgeordnete der rechtsextremen Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformisten (ECR) Bert-Jan Ruissen bei den Beratungen über die EU-Naturschutzverordnung, dass „zu viel Land der Naturwiederherstellung gewidmet“ sei. Wie mehrere andere Vertretende des rechten Flügels griff er das Argument auf, dass Naturschutz die wirtschaftliche Stabilität untergräbt.
Zusammenfassung: Die Verordnung zur Wiederherstellung der Natur war eine Schlüsselkomponente des europäischen Grünen Deals, mit dem der Verlust der biologischen Vielfalt rückgängig gemacht und der Klimawandel eingedämmt werden sollte. Ursprünglich war nur geplant, einen Teil der als geschädigt geltenden Flächen und Meere in der EU wiederherzustellen, danach wäre keine weitere Verschlechterung des Ökosystems mehr erlaubt gewesen. Die Kommission legte ihren Vorschlag 2022 vor und setzte sich zum Ziel, bis 2030 „mindestens 20 % der europäischen Meeres- und Landflächen“ und „30 % der Lebensräume in schlechtem Erhaltungszustand“ wiederherzustellen – gefolgt von einer 100-prozentigen Wiederherstellung der bedürftigen Ökosysteme bis 2050.
Rechtsextreme Politiker*innen waren nicht die einzigen, die das Dossier nicht begrüßten: In Erwartung einer Verschiebung begann die Mitte-Rechts-Partei Europäische Volkspartei (EVP), Bedenken über umweltpolitische Maßnahmen zu schüren: Sie könnten Landwirtinnen und Landwirte, die Lebensmittelversorgung und die wirtschaftliche Stabilität gefährden. Als sich die EU den Parlamentswahlen im Sommer 2024 näherte und sich die politische Debatte zu erhitzen begann, wurden Aussagen wie die von Ruissen zum gängigen Argument rechter Parteien, um den Grünen Deal zu untergraben und so Stimmen zu gewinnen.
Als die Europawahl 2024 näher rückte, wollten rechte Kandidierende die Mehrheit aus dem Jahr 2019 verschieben: Sie war in der Tat ziemlich fortschrittlich, und die Grünen spielten zum ersten Mal eine entscheidende Rolle, was unter anderem öffentlichen Bewegungen wie Fridays for Future zu verdanken war.
Der niederländische Europaabgeordnete der rechtsextremen Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformisten (ECR), Bert-Jan Ruissen, und seine Kolleginnen und Kollegen begannen eine Reihe von Aktionen mit dem Ziel, den Grünen Deal möglichst zu demontieren, aber zumindest sein Tempo unter dem Vorwand der sozialen Gerechtigkeit zu verlangsamen und ihn als wirtschaftliche Bedrohung darzustellen. Ruissen war bis Februar 2024 im Ausschuss für Landwirtschaft Schattenberichterstatter für die Entwicklung der Verordnung zur Wiederherstellung der Natur, die in der öffentlichen Debatte als „Naturgesetz“ bezeichnet wird.
Da ein grüner Übergang kostspielig sei und das Risiko berge, die Bürger*innen zurückzulassen, deren Arbeitsplätze und ganzes Leben noch auf traditionellen Produktionsweisen beruhen, müsse er überarbeitet und „pragmatischer“ oder „realistischer“ gestaltet werden, so die Rechtsextremen.
Für die ehemalige EVP-Abgeordnete Marlene Mortler, die einen Bericht zur Ernährungssicherheit verfasst hat, darf der „Grüne Deal die Ernährungssicherheit nicht gefährden“ – sie sieht das als potenzielles Risiko an, da mehr Land durch Schutzmaßnahmen „nutzlos“ wird.
Der EVP-Vorsitzende Manfred Weber rief zu einer vollständigen Ablehnung des Kommissionsvorschlags auf: „Das Ziel des Gesetzes ist es, die Natur in den Zustand von 1950 zurückzuversetzen“. „Es fordert die lokalen und regionalen Regierungen heraus, das Unmögliche zu tun: 70 Jahre Veränderungen in der Natur in etwa 25 Jahren rückgängig zu machen“, fügte er hinzu.
Eine Reihe von unglücklichen Ereignissen
Gegner*innen des Gesetzes haben fälschlicherweise behauptet, dass weite Teile des Ackerlandes wieder verwildert werden sollen.
In Wirklichkeit enteignet das Gesetz kein Ackerland, da es degradierten Ökosystemen Vorrang einräumt und ausdrücklich die Notwendigkeit anerkennt, Naturschutz und wirtschaftliche Aktivitäten in Einklang zu bringen.
Das Naturschutzgesetz enthält auch Flexibilitätsmechanismen, die sicherstellen, dass die Wiederherstellungsbemühungen mit der Nahrungsmittelproduktion und den ländlichen Lebensgrundlagen vereinbar sind.
Obwohl die Gegner*innen das Gesetzgebungsverfahren zu einem schmerzhaften Unterfangen machten, erzielten die Mitgesetzgebenden in letzter Minute eine Einigung und unterzeichneten im Juni 2024 – kurz vor der Europawahl – einen endgültigen Rechtsakt.
Der Text verpflichtet die EU-Mitgliedstaaten, bis 2030 mindestens 30 % der in dem Gesetzentwurf genannten Lebensraumtypen wiederherzustellen, wobei Schutzgebiete im Rahmen des bestehenden Natura 2000-Netzwerks Vorrang haben. Nun haben die 27 EU-Mitgliedstaaten bis zum 1. September 2026 Zeit, der Kommission ihre Entwürfe für nationale Wiederherstellungspläne vorzulegen.
Ruissens Behauptung, die weder durch wissenschaftliche Beweise noch Daten aus öffentlichen Konsultationen gestützt wird, war der perfekte Weg, um den Ruf des Grünen Deals zu ruinieren. Im Jahr 2025 zahlt die Politik noch immer den Preis dafür.
„Als sich die Proteste ausbreiteten, begannen die Agrarlobbys und die konservative Rechte, dies auszunutzen“, so Associazione Terra.
Mit gewissem Erfolg: Im vergangenen Jahr fielen mehrere europäische Gesetzesvorhaben entsprechenden Befürchtungen zum Opfer.
Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) wurde geändert, damit Landwirtinnen und Landwirte EU-Agrarsubventionen auch dann erhalten können, wenn sie die Umweltstandards der Gemeinschaft, die so genannten Konditionalitätsregeln, nicht einhalten.
Das Europäische Parlament lehnte einen Text für einen Vorschlag zur Begrenzung des Einsatzes von Pestiziden ab.
Die Verordnung über entwaldungsfreie Produkte wurde verzögert, nachdem konservative Parteien darauf gedrängt hatten, die Anforderungen für Dritte zu verwässern.
Die Emissionen aus der intensiven Landwirtschaft wurden in den Zielen für 2040 nicht mit den Industrieemissionen gleichgesetzt.
Die Farm to Fork-Strategie, die Agrar- und Lebensmittelkomponente des vorherigen Mandats, sollte ebenfalls für tot erklärt werden.
Neoliberale Agrarpolitik
Ein genauerer Blick auf die Proteste der Landwirtinnen und Landwirte, die oft als direkte Reaktion auf die Politik zur Wiederherstellung der Natur dargestellt werden, zeigt jedoch, dass ihr Hauptinteresse an anderer Stelle liegt.
Das EU-Mercosur-Handelsabkommen beispielsweise birgt das Potenzial, dass billigere Agrarprodukte aus Lateinamerika den EU-Markt stören.
Die internationale Bewegung La Via Campesina wies darauf hin, dass die Landwirtinnen und Landwirte es im Jahr 2024 „satt haben, ihr Leben lang ununterbrochen zu arbeiten, ohne jemals ein angemessenes Einkommen zu erhalten.“
„Nach jahrzehntelanger neoliberaler Agrarpolitik und Freihandelsabkommen sind wir an diesem Punkt angelangt“, heißt es: „Die Produktionskosten sind in den letzten Jahren stetig gestiegen, während die an die Landwirtinnen und Landwirte gezahlten Preise stagniert haben oder sogar gesunken sind [...] Seit den 1980er Jahren wurden verschiedene Regelungen, die den europäischen Landwirtinnen und Landwirten faire Preise sicherten, abgebaut. Die EU setzte voll und ganz auf Freihandelsabkommen, die alle Landwirtinnen und Landwirte der Welt in Konkurrenz zueinander setzten und sie ermutigten, auf Kosten ihres eigenen Einkommens und ihrer wachsenden Verschuldung zum niedrigstmöglichen Preis zu produzieren. Ökologisch zu produzieren hat enorme Vorteile für die Gesundheit und den Planeten, aber es ist teurer für die Landwirtinnen und Landwirte, und deshalb müssen die Agrarmärkte geschützt werden, um den agrarökologischen Übergang zu erreichen. Leider wurden wir nicht gehört.“
Was die Daten sagen
Entgegen der Behauptung, dass die Erhaltung von Land die wirtschaftliche Stabilität untergräbt – wenn das überhaupt stimmt –, zeigt die Forschung, dass die Nichtwiederherstellung geschädigter Ökosysteme ein weitaus größeres finanzielles Risiko darstellt.
Der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) zeigt auf, wie die Verschlechterung der Ökosysteme die landwirtschaftliche Produktivität und die Ernährungssicherheit direkt bedroht: „Der beobachtete Klimawandel beeinträchtigt bereits die Ernährungssicherheit durch steigende Temperaturen, veränderte Niederschlagsmuster und eine größere Häufigkeit einiger Extremereignisse“ und „die Ernährungssicherheit dürfte durch den prognostizierten zukünftigen Klimawandel zunehmend beeinträchtigt werden“.
Darüber hinaus, so der IPCC weiter, „sind etwa 21-37 % der gesamten Treibhausgasemissionen dem Ernährungssystem zuzuschreiben“.
Ausgehend vom derzeitigen Nahrungsmittelsystem schätzt die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), dass bis 2050 etwa 50 % mehr Nahrungsmittel produziert werden müssen, um die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren. „Dies würde zu einem erheblichen Anstieg der Treibhausgasemissionen und anderen Umweltauswirkungen führen, einschließlich des Verlusts der biologischen Vielfalt“, so der IPCC.
Mit 2 Milliarden Menschen mehr auf dem Planeten Erde können wir es uns einfach nicht leisten, so weiterzuleben wie bisher. Und dabei geht es nicht allein um den Platz: Nur neue, nachhaltige Formen der Landwirtschaft können die Probleme lösen, die die industrielle Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten geschaffen hat.
„Die Kombination von angebotsseitigen Maßnahmen wie effizienter Produktion, Transport und Verarbeitung mit nachfrageseitigen Eingriffen wie der Änderung der Lebensmittelauswahl und der Verringerung von Lebensmittelverlusten und -abfällen reduziert die Treibhausgasemissionen und erhöht die Widerstandsfähigkeit des Lebensmittelsystems“, so der IPCC.
Das Beratungsunternehmen PwC schätzt, dass über 50 % des weltweiten BIP durch den Verlust der biologischen Vielfalt gefährdet sind, was bedeutet, dass der Schutz der Natur ein wirtschaftliches Gebot und kein Hindernis ist.
Das World Resources Institute (WRI) hat nachgewiesen, dass Klimafinanzierungsinvestitionen in die Wiederherstellung der Natur zu erheblichen wirtschaftlichen Erträgen und zur Schaffung von Arbeitsplätzen führen.
Wir brauchen zwar eine Vision, aber in einer Zeit der Kriege und der Angst ist dies unbestreitbar schwer vorzuschlagen.
Andere klimapolitische Maßnahmen stoßen im Namen des Status quo auf starken Widerstand.
Es ist kein Zufall, dass dieselbe Rhetorik, die für den Angriff auf das Naturgesetz verantwortlich ist, auch hinter einem Rollback in der Energiepolitik steht.
Während die Erneuerbare-Energien-Richtlinie der EU den angestrebten Anteil erneuerbarer Energien am EU-Verbrauch bis 2030 auf 42,5 % anhob, mit einer zusätzlichen indikativen Aufstockung um 2,5 %, die es der EU ermöglichen würde, 45 % zu erreichen, äußerten einige ihre Besorgnis, dass die landwirtschaftliche Produktion auch deshalb in Gefahr sei, weil erneuerbare Energien um die verfügbaren Flächen konkurrieren.
In einer Studie des Europäischen Umweltbüros (EEB) und einem Bericht des Branchenverbandes der europäischen Elektrizitätswirtschaft Eurelectric heißt es jedoch, dass die biologische Vielfalt und die Stromnetze nebeneinander bestehen können, ohne die Natur oder die Nahrungsmittelproduktion zu gefährden.
Die Konservativen sagen, der Planet sei zu klein für die Koexistenz der Aktivitäten, die ihn zerstören und der Aktivitäten, die ihn retten wollen. Sie haben Recht, aber welche Aktivitäten sollten Ihrer Meinung nach aufgegeben werden?
Angesichts der zunehmenden Klimarisiken halten Wissenschaftler*innen die Wiederherstellung der Natur nicht für einen Luxus, sondern für eine Notwendigkeit. Mit anderen Worten: Die Erhaltung und Wiederherstellung von Ökosystemen ist keine Bedrohung für die wirtschaftliche Stabilität – sie ist eine Absicherung gegen den künftigen Zusammenbruch.

Dieser Artikel wurde mit Unterstützung des Europäischen Medien- und Informationsfonds (EMIF) erstellt. Er gibt nicht unbedingt die Positionen des EMIF und der Fonds-Partner, der Calouste Gulbenkian Foundation und des Europäischen Hochschulinstituts wieder.
Die alleinige Verantwortung für alle vom Europäischen Medien- und Informationsfonds unterstützten Inhalte liegt bei den Autoren und spiegelt nicht unbedingt die Positionen des EMIF und der Fonds-Partner, der Calouste Gulbenkian Foundation und des European University Institute wider.
Schätzen Sie unsere Arbeit?
Dann helfen Sie uns, multilingualen europäischen Journalismus weiterhin frei zugänglich anbieten zu können. Ihre einmalige oder monatliche Spende garantiert die Unabhängigkeit unserer Redaktion. Danke!