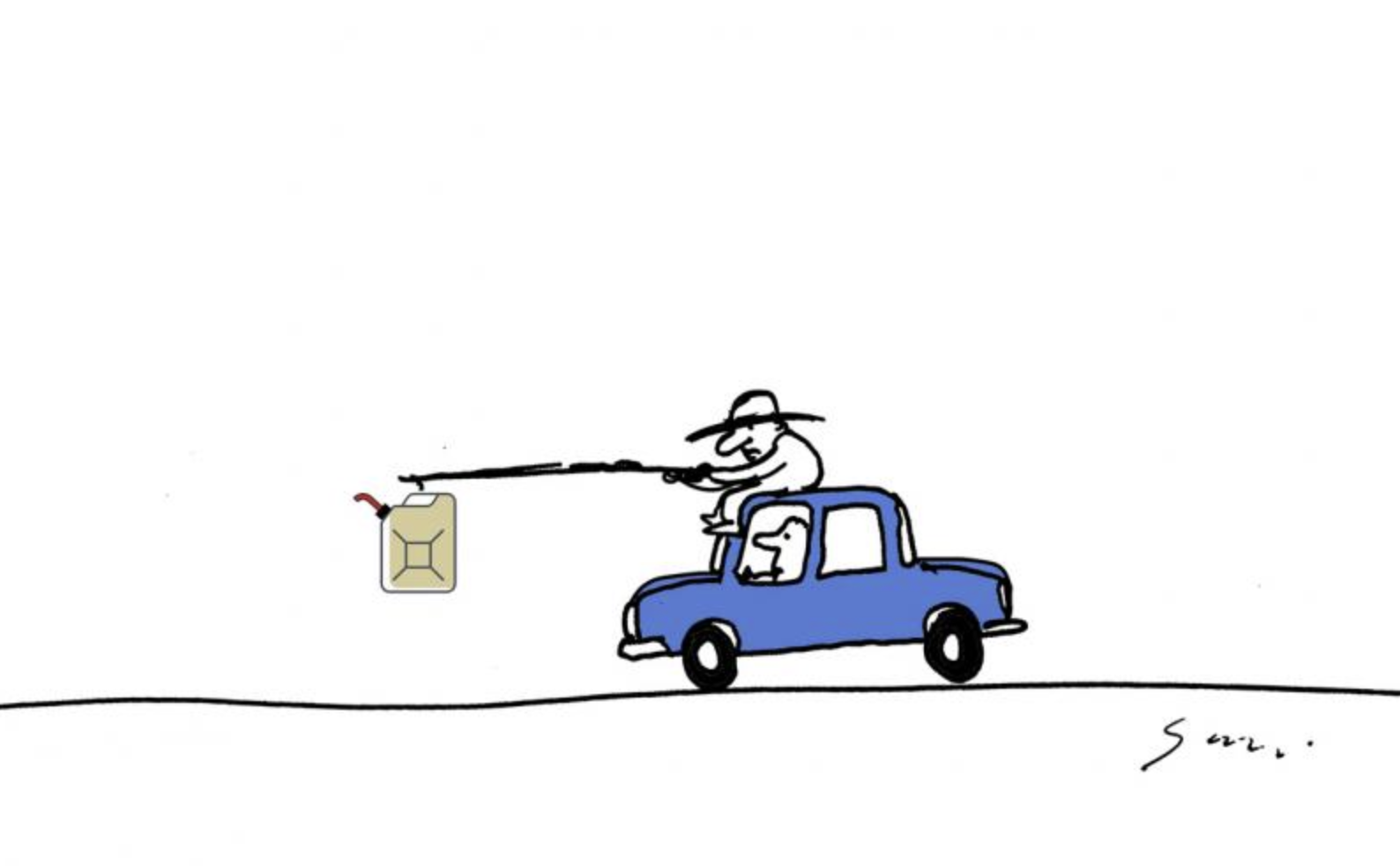Autos sind für 12 % der gesamten CO₂-Emissionen der Europäischen Union verantwortlich. Da Europa strengere Ziele für die Emissionsreduzierung (mindestens 55 % bis 2030) einführt, wird die CO₂-Belastung durch Neuwagen zu einem immer wichtigeren Aspekt im Marketing der Automobilkonzerne. Geringere Emissionen bedeuten oft Zugang zu überfüllten Stadtzentren, niedrigere Innenstadtmaut und manchmal eine großzügige Förderung.
Transportkosten machen mehr als 10 % des durchschnittlichen Budgets der europäischen Haushalte aus, wobei der Besitz eines Autos den größten Einzelposten darstellt. Für viele Menschen, insbesondere für Mietende, ist ein Auto oft der wertvollste Besitz. Kein Wunder also, dass es für die meisten Europäer*innen eine sorgfältig abgewogene Investition ist. Aber können die Interessierten den Emissionsangaben der Herstellenden vertrauen, wenn sie ein Fahrzeug kaufen oder das vorhandene ersetzen wollen? Unsere Untersuchung in drei europäischen Ländern zeigt, dass die von der Automobilindustrie angegebenen Emissionen in der Regel weit unter den im realen Alltag gemessenen Werten liegen.
Eine gründliche Analyse der CO₂-Emissionsdatenbanken, die von der Europäischen Umweltagentur (EEA) veröffentlicht wurden, zeigt das volle Ausmaß der Diskrepanz zwischen Labor- und realen Emissionen von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor und Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen (PHEVs) in Frankreich, Italien und Rumänien zwischen 2021 und 2023. Unter den getesteten Modellen befanden sich mehrere der meistverkauften Autos in jedem Land, und einige von ihnen kamen für öffentliche Subventionen in Frage, die den Übergang zu emissionsarmen Verkehrsmitteln unterstützen sollen.
Noch schlimmer ist, dass die Diskrepanz zwischen den in offiziellen Dokumenten erfassten CO₂-Emissionen und den in der Realität beobachteten Emissionen im Zeitraum 2021–2023 tendenziell zunahm. Bei benzin- und dieselbetriebenen Fahrzeugen stieg sie in Rumänien von 29,8 % auf 30,4 %, in Italien von 20,3 % auf 21 % und in Frankreich von 19 % auf 19,7 %. Bei Plug-in-Hybridfahrzeugen waren die Diskrepanzen sogar noch größer: Sie lagen zwischen 350 % und 550 %.
Wie konnte es so weit kommen?
Italien und der Ecobonus
In Italien steht die „Ecobonus“-Förderung unter bestimmten Voraussetzungen Unternehmen und Privatpersonen zur Verfügung, die neue und umweltfreundlichere Autos kaufen möchten, „um die Senkung der CO₂-Emissionen im Einklang mit den EU-Vorschriften zu fördern“. In den letzten Jahren hat das Industrieministerium zunehmend öffentliche Gelder investiert, um dieses Ziel zu erreichen. Im von uns analysierten Zeitraum 2021–2023 wurden etwa 70 % der von der Regierung bereitgestellten Subventionen in Höhe von 2,093 Milliarden Euro (1,45 Milliarden Euro) für den Kauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor verwendet. Logischerweise handelte es sich dabei um die Fahrzeuge mit den höchsten Emissionen, die jedoch erst ab 2025 vom Ecobonus ausgeschlossen werden.
Nehmen wir zum Beispiel die in Italien meistverkauften Modelle mit erheblichen CO₂-Abweichungen für den Zeitraum 2021–2023, und von diesen nur diejenigen, die für eine Kaufprämie in Frage kamen. Anhand der disaggregierten Daten der Europäischen Umweltagentur (EEA) haben wir festgestellt, dass das Auto mit der schlechtesten Leistung der Citroën C3 ist (Benziner mit einem Hubraum von 1200 ccm und einer Leistung von 81 kW). Seine tatsächlichen CO₂-Emissionen lagen um 34,8 % über den im Labor gemessenen Werten. Es folgt der Fiat Panda (Benziner, 1000 ccm, 52 kW) mit einer Differenz von 34,1 % und der Dacia Sandero (Benziner, 1000 ccm, 67 kW) mit einer Differenz von 29,7 %.
Unsere Untersuchungen zeigen für Frankreich und Rumänien ziemlich ähnliche Ergebnisse.
Frankreichs Ökobonus
In Frankreich wurden mehrere Maßnahmen ergriffen, um den Umstieg auf umweltfreundlichere Fahrzeuge zu fördern. Der Bonus Ecologique war eine Subvention für den Kauf eines Neufahrzeugs, insbesondere von Elektrofahrzeugen. Er sollte emissionsarme oder emissionsfreie Autos erschwinglicher machen, wurde jedoch 2025 eingestellt. Der im Jahr 2015 eingeführte Umstellungsbonus verfolgte einen anderen Ansatz: Er förderte den Ersatz eines alten Fahrzeugs durch ein umweltfreundlicheres Modell, entweder neu oder gebraucht.
Im Gegenzug für die Verschrottung eines alten Autos konnten die Bürger*innen (insbesondere einkommensschwache Haushalte) eine finanzielle Unterstützung für den Kauf oder das Leasing eines als umweltfreundlicher geltenden Fahrzeugs erhalten. Dieses Programm wurde im Jahr 2024 eingestellt.
Rumäniens „Rabla”
In Rumänien wurde 2013 das Programm „Rabla“ ins Leben gerufen, um den Kauf einer begrenzten Anzahl von Neuwagen zu subventionieren, wobei die Mittel aus dem Verkauf von grünen Zertifikaten (auch bekannt als CO₂-Emissionszertifikate) stammen. Wie in Frankreich besteht das Ziel darin, die Gesamt-CO₂-Emissionen des Fahrzeugbestands zu reduzieren, indem alte Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen und Anreize für den Kauf umweltfreundlicherer Neuwagen geschaffen werden.
Leider wurde nie gemessen, um wie viel sich die CO₂-Emissionen oder Schadstoffbelastung durch die Verschrottung alter Autos und den Kauf neuer Fahrzeuge tatsächlich verringert haben. Die rumänische Umweltfondsverwaltung (AFM) teilte uns mit, dass die Modelle der verschrotteten Autos nicht erfasst werden, sondern nur ihre Marken und die Anzahl der Einheiten pro Automobilherstellendem. Ebenso werden die Modelle der im Rahmen des Rabla-Programms gekauften Neuwagen nicht in einer öffentlichen Datenbank erfasst – nur die Anzahl der Einheiten pro Automobilherstellendem.
Laut Lucien Mathieu von der französischen Sektion der NGO Transport&Environnement sind Subventionen für Privatpersonen nur die Spitze des Eisbergs. In ganz Europa wird der Kauf von Elektro- und Verbrennungsmotorfahrzeugen durch zahlreiche Steuern beeinflusst: Anschaffungs- und Zulassungssteuern, Mehrwertsteuer, Subventionen für Firmenwagen usw.
Die Big Five antworten
Wir haben uns an die fünf umsatzstärksten Automobilherstellenden in der EU gewandt (BMW, Mercedes-Benz, Renault, Stellantis und Volkswagen) und ihnen die Ergebnisse unserer Analyse für ihre jeweiligen Automodelle vorgelegt.
„Im Vergleich zum zertifizierten WLTP-Wert sind unter realen Fahrbedingungen Abweichungen möglich“, erklärte David Börsig, Sprecher von Mercedes-Benz, gegenüber Voxeurop. „Je nach Testzyklus und Nutzungsbedingungen kann es zu absoluten Abweichungen kommen“, pflichtete Christophe Lavauzelle, Pressesprecher von Renault, bei.
Ein Sprecher von Volkswagen fügte hinzu, dass die Unterschiede bei den CO₂-Emissionen „durch eine Reihe von Faktoren erklärt werden können, wie beispielsweise zusätzliche Ausstattungen und Zubehörteile, die sich auf das Gewicht, den Rollwiderstand und die Aerodynamik auswirken, sowie durch äußere Bedingungen wie Verkehr, Wetter und – vor allem – das individuelle Fahrverhalten.“
„Ergebnisse, die mit unterschiedlichen Methoden erzielt wurden, sind nicht direkt mit den EU-Zertifizierungswerten vergleichbar“, sagte Fernao Silveira, ein Sprecher von Stellantis. „Alle unsere Fahrzeuge entsprechen vollständig den gesetzlichen Vorgaben in den Märkten, in denen sie angeboten werden.“ BMW hatte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht auf unsere Fragen geantwortet.
Eine gut etablierte Lobby in Brüssel
Im Mai 2025 stimmte das Europäische Parlament in einem Dringlichkeitsverfahren, unterstützt von der konservativen Europäischen Volkspartei und den Europäischen Konservativen und Reformern, für eine Lockerung der Emissionsgrenzwerte für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge. Der Text wurde mit einer Mehrheit von 458 Ja-Stimmen, 101 Nein-Stimmen und 14 Enthaltungen angenommen. Nur die Fraktionen der Grünen und der Linken lehnten den Änderungsantrag ab.
Ursprünglich mussten die Automobilherstellenden die CO₂-Emissionen von Neuwagen und Lieferwagen bis 2025 um 15 % gegenüber dem Basisjahr 2021 senken, um die Emissionen der EU-Flotte für die Jahre 2025-2029 bei 93,6 Gramm CO₂/km zu halten. Die Änderung legt die Ziele auf einen Dreijahresdurchschnitt (2025–2027) statt auf einen Jahresdurchschnitt fest, sodass die Automobilherstellenden die für die Nichteinhaltung im Jahr 2025 verhängten Strafen vermeiden können.
Die Maßnahme, die ursprünglich von der Europäischen Kommission am 3. März 2025 vorgeschlagen wurde, wurde als versöhnliche Geste gegenüber der europäischen Automobilindustrie interpretiert, die argumentierte, dass die schleppenden Verkäufe von Elektrofahrzeugen das Ziel für 2025 gefährdeten. Der gleiche Ansatz wurde von den meisten nationalen Behörden verfolgt, die den Vorschlag der Kommission billigten.
Nur Schweden und Belgien enthielten sich der Stimme. Romina Pourmokhtari, die schwedische Umweltministerin, erklärte gegenüber Voxeurop, dass die schwedische Regierung die Änderung mit der Begründung kritisiert habe, sie würde diejenigen „schwedischen Unternehmen benachteiligen, die ihre Verantwortung wahrgenommen und den Weg für den Klimawandel geebnet haben“ (indem sie die aktuellen Vorschriften einhalten). Die belgische Delegation lehnte eine Stellungnahme ab.
„[Angesichts der Tatsache, dass] die Durchschnittsberechnung die CO₂-Ziele für 2025 effektiv verzögert, werden weniger Elektrofahrzeuge neu zugelassen werden, als dies sonst der Fall wäre“, kommentiert der Internationale Rat für sauberen Transport (ICCT). Stattdessen werden mehr Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und vergleichbar hohen Emissionen zugelassen werden, stellt die NGO fest, die sich für Nachhaltigkeit im Transport einsetzt.
Diese Neufahrzeuge werden im Durchschnitt etwa 250.000 km gefahren, bevor sie am Ende ihrer Lebensdauer aus dem Verkehr gezogen werden. „Wenn man bedenkt, dass die CO₂-Emissionen im realen Fahrbetrieb durchschnittlich 19 % über den offiziellen Werten liegen“, warnen die Experten des ICCT, dass „jedes zusätzliche Gramm der CO₂-Emissionen der Typgenehmigung im realen Fahrbetrieb im Durchschnitt zu zusätzlichen CO₂-Emissionen der Flotte von etwa 3,2 Millionen Tonnen führt“.
Der ursprüngliche Vorschlag der Kommission (und die anschließende Abstimmung im Europäischen Parlament) folgte auf eine intensive Phase der Lobbyarbeit durch mehrere Akteure aus dem Automobilsektor.
Die Automobilindustrie ist in der EU-Hauptstadt stark vertreten. Große Unternehmen wie Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Renault und Stellantis sind einzeln repräsentiert und können gemeinsam auf Organisationen wie den Europäischen Automobilherstellenden-Verband (ACEA) zurückgreifen. Mit einem Lobbying-Budget von über 14 Millionen Euro für 2025 gehört die Branche zu denjenigen mit den höchsten Ausgaben (Platz sechs im Corporate Europe Observatory (CEO) und LobbyControl's EU-Ranking für Lobbying-Ausgaben).
Allein im Jahr 2025 verfügte der ACEA über ein Budget von über 5 Millionen Euro, um die Interessen des Automobilsektors zu vertreten. Dies könnte jedoch nur die Spitze des Eisbergs sein: Ähnliche Organisationen haben ihr Budget für das laufende Jahr nicht offengelegt.
Diese Investitionen in Lobbyarbeit spiegeln sich in regelmäßigen Kontakten zwischen der Branche und den europäischen Institutionen wider. Zwischen September 2024 und Juni 2025 trafen sich die sechs von CEO und LobbyControl identifizierten Organisationen (ACEA, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Michelin und FIGIEFA) mehr als 90 Mal mit EU-Beamtinnen und -Beamten. Im Vergleich dazu tat die NGO Transport&Environment dies im selben Zeitraum 27 Mal. In diesen Zahlen sind andere wichtige Akteurinnen, Akteure und Herstellende, die auf nationaler oder europäischer Ebene tätig sind, nicht enthalten.
Mit einem Lobbying-Budget von über 14 Millionen Euro für 2025 gehört die Branche zu denjenigen mit den höchsten Ausgaben (Platz sechs im Corporate Europe Observatory (CEO) und LobbyControl's EU-Ranking für Lobbying-Ausgaben)
Der ACEA hat sich wiederholt bei EU-Vertretenden für ein mehrjähriges Konformitätssystem eingesetzt. In seinen Argumenten verweist er auf Rekordstrafen für Herstellende und die Gefährdung der Energiewende. Im Zeitraum, auf den sich unsere Anfrage bezieht, haben wir etwa fünfzehn E-Mails, Briefings und Positionspapiere gesammelt, in denen die Position des ACEA dargelegt wird.
Diese Teilzahlen lassen zwar nicht den Schluss zu, dass allein die Lobbyarbeit der Automobilindustrie die Entscheidung der Europäischen Kommission beeinflusst hat, sie unterstreichen jedoch die bedeutende Präsenz des Sektors auf höchster Ebene der EU-Institutionen. Dies geht auch eindeutig aus Dokumenten hervor, die Voxeurop von der Generaldirektion Klimapolitik (DG CLIMA) und der Generaldirektion Binnenmarkt und Industrie (DG GROW) erhalten hat und die den Zeitraum Januar bis Oktober 2024 und Januar bis April 2025 abdecken.
Ein Dokument vom 18. September 2024, das Voxeurop vorliegt, besagt beispielsweise, dass der ACEA Ursula von der Leyen auf den „Trend einer Stagnation des Marktanteils von batterieelektrischen Fahrzeugen in der EU“ hingewiesen hat. Der Verband forderte die Präsidentin der Europäischen Kommission auf, „dringende Hilfsmaßnahmen zu ergreifen, bevor 2025 neue CO₂-Ziele für Pkw und Lieferwagen in Kraft treten“. Der ACEA äußerte sich außerdem besorgt über die Aussicht auf Strafen in Höhe von mehreren Milliarden Euro.
Auf der anderen Seite waren große Automobilherstellende wie BMW und Stellantis gegen solche Änderungen. In einem Schreiben, das Stellantis am 10. Oktober 2024 an Von der Leyen sandte, bekräftigte der Konzern (zu dem bekannte italienische Marken wie Fiat und Alfa Romeo gehören), dass er gegen eine mögliche Änderung der CO₂-Ziele für 2025 sei.
Erstens, weil dies „die Wettbewerbsbedingungen erheblich verzerren würde, indem bestimmte Automobilherstellende gegenüber den vorbildlichen Herstellenden begünstigt würden, die die erforderlichen Investitionen und Anpassungen ihres Geschäftsmodells vorgenommen haben, um die Vorschriften einzuhalten. Zweitens, weil übereilte Änderungen die Stabilität und Vorhersehbarkeit des Rechtsrahmens untergraben würden, die in dieser Zeit des industriellen Wandels so dringend benötigt werden.“
Europas zweitgrößter Automobilherstellender gab erst öffentlich bekannt, dass er seine Position revidiert habe, nachdem Ursula von der Leyen eine gewisse Flexibilität bei der Erreichung des CO₂-Ziels angekündigt hatte. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war von Stellantis noch kein Kommentar zu dieser Strategieänderung abgegeben worden.
In einer Unterrichtung an den Generaldirektor der GD CLIMA, Kurt Vandenberghe, vom 15. Januar 2025 vertrat der ACEA die Auffassung, dass „die politische Dynamik auf einem mehrjährigen Durchschnittsmechanismus zur Einhaltung der Vorschriften beruht, den er ebenfalls unterstützen würde“.
In einem an Wopke Hoekstra, den EU-Kommissar für Klima, Netto-Null-Emissionen und sauberes Wachstum, gerichteten Dokument vom 5. Februar 2025 versicherte der ACEA, dass ein System mit Mehrjahresdurchschnitt keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt haben werde, da „jede ‚Nichteinhaltung‘ ausgeglichen werden muss“. Ein solches System, so das Dokument, „bietet die Möglichkeit, auf kurzfristige Marktschwankungen zu reagieren, sodass die Automobilherstellenden die CO₂-Reduktionsziele stetig und nicht durch abrupte, auf die Einhaltung der Vorschriften ausgerichtete Maßnahmen erreichen können“.
Kurz nach dem zweiten Treffen des Strategischen Dialogs über die Zukunft der europäischen Automobilindustrie, bei dem wichtige Interessengruppen mit hochrangigen EU-Vertretenden, darunter Von der Leyen, zusammentrafen, und im Anschluss an den Vorschlag der Kommission sandte der ACEA ein Schreiben an Hoekstra, in dem er die Geste gegenüber der Automobilindustrie begrüßte.
Trotz wiederholter Anfragen lehnte der ACEA es ab, unsere Fragen zu seinen Beziehungen zu den europäischen Institutionen zu beantworten.
Argumente, die nicht überzeugen
Die meisten Argumente der Branche haben Transport&Environment nie überzeugt. „Und dennoch hat ein Automobilherstellender nach dem anderen übertriebene Aussagen über die ‚Krise‘ und mögliche Strafen gemacht und allen anderen vorgeworfen, nicht genug zu tun. Sie fordern, dass die CO₂-Ziele der EU für Autos abgeschafft werden, damit sie mehr Umweltverschmutzung verursachen können.
Gleichzeitig erzählen sie den Investierenden, dass sie die Ziele einhalten können“, sagt Julia Poliscanova, Senior Director der Abteilung für Fahrzeuge, Elektrifizierung und Batterie-Lieferketten bei T&E. Die NGO beanstandet auch die Art und Weise, wie die Automobilbranche die Strafen für die Nichteinhaltung berechnet hat, und bezeichnet die Zahl von 15 Milliarden als „übertrieben“.
Lucien Mathieu, Experte für die Automobilindustrie bei T&E, erklärte gegenüber Voxeurop, dass die Stagnation der Verkaufszahlen für Elektrofahrzeuge im Jahr 2024 nicht in erster Linie auf mangelndes Interesse oder fehlende Infrastruktur zurückzuführen, sondern vielmehr das Ergebnis der „Stop-and-Go“-Logik des europäischen Marktes sei. Die Herstellenden warten oft bis zum letzten Termin für die europäischen Normen, um den Absatz von Elektrofahrzeugen anzukurbeln und die Umweltziele zu erreichen.
Wie der Direktor des ICCT Europe, Dr. Peter Mock, jedoch kürzlich feststellte, „ist die Umstellung auf Elektrofahrzeuge in Europa auf Kurs und beschleunigt sich. Die Autoherstellenden sind nur noch 9 Gramm von ihrem nächsten CO₂-Ziel für 2027 entfernt. Die bevorzugte Strategie, um dieses Ziel termingerecht zu erreichen, ist der Verkauf von mehr batterieelektrischen Autos, was keine Überraschung ist. Die Batteriekosten sinken rapide, die Ladeinfrastruktur wird ausgebaut und batterieelektrische Autos werden schneller als erwartet sauberer.“
Die jüngsten Daten, die vom ICCT erhoben wurden, zeichnen ein kontrastreiches Bild. Während in Europa die Zulassungen von Elektrofahrzeugen von 18 % im Juni auf 17 % im Juli 2025 zurückgingen, war im selben Jahr ein durchschnittlicher Gesamtanstieg um 4 % (von 13 % auf 17 %) im Vergleich zu 2024 zu verzeichnen. Obwohl es den Herstellenden gelungen ist, ihre Interessen mit der Änderung der EU-Verordnung zu CO₂-Emissionszielen zu schützen, erfüllt derzeit nur BMW (mit durchschnittlichen Emissionen 1 % unter dem Grenzwert) die neuen Ziele für den Zeitraum 2025-2027. Alle anderen Herstellenden oder ihre jeweiligen Pools (Herstellendengruppen) würden derzeit die Grenzwerte überschreiten: Volkswagen um 14 %, Stellantis um 7 %, Renault um 6 % und Mercedes-Benz um 4 %.
Der Kampf ist gerade erst gewonnen, doch die Automobilbranche und ihre Verbündeten bereiten sich bereits auf den nächsten vor. Das Ziel ist das Jahr 2035 und die Reduzierung der CO2-Emissionen um 100 %. Im September 2025 kündigte die Europäische Kommission an, bis Ende des Jahres eine Überprüfung ihres Null-Emissions-Ziels für 2035 vorzulegen.
Methodischer Hinweis
Wir haben offizielle Daten der Europäischen Umweltagentur (EEA) verwendet, die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union bereitgestellt wurden. Um die durchschnittlichen Abweichungen der CO₂-Emissionen auf Ebene der Automodelle zu vergleichen, haben wir Fahrzeuge mit den folgenden Merkmalen berücksichtigt: Automobilherstellender, Modell (Handelsname), Kraftstoffart/-modus, Motorleistung, Hubraum und CO₂-Emissionen in g/km (WLTP). Außerdem haben wir das Zulassungsjahr berücksichtigt. Der Internationale Rat für sauberen Transport (ICCT) hat uns bei der Datenbereinigung und -aggregation unterstützt.
🤝 Diese Untersuchung wurde mit Unterstützung von Journalismfund Europe und IJ4EU durchgeführt. Das International Press Institute (IPI), das European Journalism Centre (EJC) und alle anderen Partner des IJ4EU-Fonds sind nicht für die veröffentlichten Inhalte und deren Verwendung verantwortlich.


Schätzen Sie unsere Arbeit?
Dann helfen Sie uns, multilingualen europäischen Journalismus weiterhin frei zugänglich anbieten zu können. Ihre einmalige oder monatliche Spende garantiert die Unabhängigkeit unserer Redaktion. Danke!