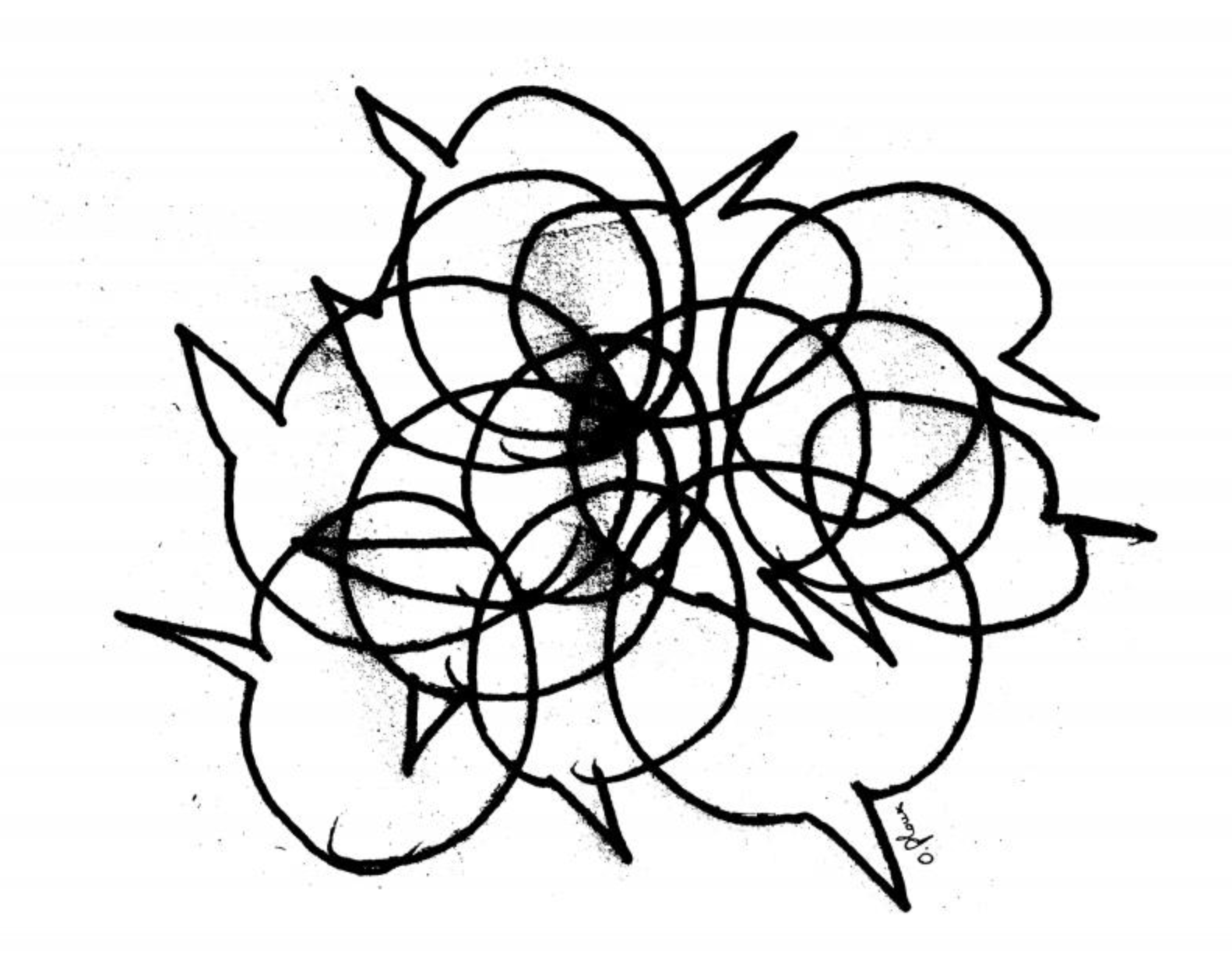Bei der vom Europäischen Parlament organisierten Wahlparty hatte jede Fraktion einen Raum, in dem sie die Ergebnisse verfolgen, die Presse treffen – über 1000 Journalistinnen und Journalisten waren akkreditiert – und Besucher empfangen konnte. Die fröhlichste Stimmung herrschte nicht im Raum der Europäischen Volkspartei (EVP, rechts), obwohl sie als stärkste Kraft aus dem Wahlkampf hervorging, und auch nicht in dem der konservativen EKR-Fraktion, die ebenfalls einen gewissen Zuwachs verzeichnen konnte: Die Fraktion der Grünen, die die schwersten Verluste auf europäischer Ebene hinnehmen mussten, zeigte die größte Begeisterung.
Zusammen mit den Liberalen, aber in geringerem Maße, sind die Grünen in der Tat die großen Verlierer der Europawahl vom 6. bis 9. Juni (zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels sind die Ergebnisse noch vorläufig), aus denen die Parteien als Sieger hervorgingen, die von der Rechten bis zur extremen Rechten reichen.
Kann man dennoch von einer „braunen Welle“ (oder schwarzen Welle) sprechen? Vielleicht nicht in dem Maße, wie man es vor den Wahlen hätte befürchten können.
In Frankreich, Deutschland, Italien und Österreich ist tatsächlich eine solche zu verzeichnen. Anders sieht es jedoch in den mittel- und osteuropäischen Ländern aus, wo „Parteien, die ein pro-russisches Narrativ verbreiten, jedoch eine bedeutende Anzahl von Sitzen errungen haben“, wie Visegrad Insight beobachtet. Ebenso wie in den nordischen Ländern, wo die populistische Welle bereits vorbei zu sein scheint und wo es eher zu einem leichten Rückschlag oder sogar zu einem Erstarken der linken Parteien kommt.
Zu beachten ist, dass in Frankreich und Italien die rechtsextremen Parteien – die der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) und Identität und Demokratie (ID) im Europäischen Parlament angehören – bereits 2019 an die Spitze gelangt waren. In jedem Fall machen die Parteien der radikalen Rechten heute europaweit etwa 21 % der Stimmen und etwa ein Viertel der Sitze im Europäischen Parlament aus. Insgesamt sind diese Parteien zwischen 2019 und 2024 um fast 2 % gewachsen. Nicht mitgezählt sind hier die Fraktionslosen, von denen man sich aufgrund der Ergebnisse früherer Wahlen vorstellen kann, dass sie sich im Verhältnis ein Drittel zu zwei Dritteln auf die extreme Linke und die extreme Rechte verteilen.
So kommt der italienische Ökonom Alberto Alemanno auf X zu folgendem Schluss: „Entgegen den Erwartungen hat diese Europawahl die EU NICHT der extremen Rechten überlassen. [...] Anstattdessen bleibt die Pro-EU-Mehrheit – die die EU historisch gesehen in den letzten 50 Jahren geführt hat – an der Spitze“.
Ebenfalls auf X resümiert die italienische Politologin Nathalie Tocci die Situation in Anlehnung an eine bekannte Formel aus Tommasi di Lampedusas „Der Leopard“ sehr treffend: „Die Europawahl hat die Rechtswelle bestätigt und widerlegt. In Frankreich und Deutschland hat sie sich bestätigt, in anderen Mitgliedstaaten jedoch dementiert. Selbst in Italien hat Fratelli d'Italia [die Partei von Giorgia Meloni] ein gutes Ergebnis erzielt, das jedoch niedriger ist als das der Lega im Jahr 2019. Auf EU-Ebene ändert sich alles, damit sich nichts ändert, aber angesichts der immensen Herausforderungen, die auf die EU zukommen, ist das negativ genug“.
In vielen anderen Ländern – Belgien, Dänemark, Finnland, Griechenland, Ungarn, Niederlande, Polen, Tschechische Republik, Rumänien und Schweden – scheinen rechtsextreme Parteien dagegen unterdurchschnittlich abgeschnitten zu haben, unterstreicht auf X auch der niederländische Politologe Cas Mudde. Er stellt fest, dass der Aufschwung der radikalen Rechten hauptsächlich auf ihre Ergebnisse in Deutschland, Frankreich und Italien zurückzuführen ist, wobei er betont, dass „sie auf EU-Ebene im Vergleich zu den Standards von 2024 unterrepräsentiert war“.
Davon abgesehen, so fährt er fort, „nimmt die extreme Rechte einen viel größeren Platz ein, als sie sollte“, und hat „die Debatte um die Einwanderung weitgehend gewonnen und die Debatten über den Europäischen Grünen Deal und die Frage von Geschlecht/Sexualität vorangetrieben“. Die Antithese, dass „die Demokratie dem Untergang geweiht ist“, ist „unzutreffend und nicht hilfreich“, so Mudde weiter, „die Parteien, die sich auf die liberale Demokratie berufen, halten alle Hebel der Macht in der Hand. Wenn sie behaupten, dass ‚die Menschen‘ eine rechtsextreme Politik wollen oder dass sie ‚keine Wahl haben‘, sollten wir das nicht akzeptieren“. Er schlussfolgert: „Durch eine realistische statt einer sensationalistischen Berichterstattung in den Medien kann Druck auf demokratische Parteien ausgeübt werden, damit sie sich von der extremen Rechten abwenden“.
In diesem Zusammenhang richten sich die Blicke auf die EVP, den eigentlichen Dreh- und Angelpunkt im Europäischen Parlament, und ihre Fähigkeit, sich gegen den Sirenengesang der radikalen Rechten „durchzusetzen“. In seinem Beitrag zu einer Übersicht kollektiver Analysen unmittelbar nach der Wahl für The Guardian meint Mudde, dass „die EVP in ihrer Kampagne die wichtigsten Themen und Muster der extremen Rechten übernommen hat und rechter regieren wird als zuvor – mit oder ohne Hilfe der gespaltenen extremen Rechten“. Er erinnert daran, dass „die extreme Rechte nicht ‚das Volk‘ repräsentiert. Tatsächlich repräsentiert sie nur eine Minderheit der europäischen Völker. Darüber hinaus lehnen weitaus mehr Europäer*innen rechtsextreme Parteien und Politik ab“.
Für die niederländische Politikwissenschaftlerin Léonie de Jonge „hat man den Eindruck, heute einen enormen Rechtsruck zu erleben, dabei haben sich der Aufstieg und die Normalisierung rechtsextremen Denkens in allen EU-Mitgliedstaaten in den letzten 30 Jahren vollzogen“, erinnert sie am Tag nach der Wahl und dem Erfolg der Partei Vlaams Belang in Flandern in einem Interview mit der flämischen Tageszeitung De Morgen. Dieses Ergebnis überrascht Léonie de Jonge nicht: Vlaams Belang ist „zusammen mit der FPÖ in Österreich und dem Rassemblement National in Frankreich eine der ältesten rechtsradikalen Parteien in Europa“, und „hat in den letzten Jahren viel an der Organisation der Partei gearbeitet“.
Neben einer bereits laufenden Rechtsverlagerung der EU-Politik haben das Abstimmungsergebnis und die Niederlage der Grünen eine wichtige Folge für die Zukunft des Kontinents, wie Rosa Balfour, Direktorin der Denkfabrik Carnegie Europe ebenfalls in The Guardian hervorhebt: Eine Verlangsamung der Umsetzung des Europäischen Grünen Deals, da die Grünen „nicht stark genug sein werden, um sich dieser zu widersetzen“, ein Rückgang der Bürgerrechtspolitik und eine Verschärfung der Migrationspolitik, „die bereits im vergangenen Jahrzehnt von der radikalen Rechten beeinflusst wurde“.
Im selben Guardian, der für eine Tageszeitung aus einem Land, das nicht mehr Teil der EU ist, eine außergewöhnliche Berichterstattung bietet, meint der britische Historiker und Journalist Timothy Garton Ash, dass nach wie vor „eine große Mehrheit der Europäer*innen das beste Europa, das wir je hatten, nicht verlieren wollen. Aber sie müssen mobilisiert, galvanisiert und davon überzeugt werden, dass die Union existenziellen Bedrohungen gegenübersteht“. Die Verhandlungen über die Schlüsselpositionen in der EU werden unterdessen auf Hochtouren laufen. „Was wir brauchen“, schließt Garton Ash, „ist eine Mischung aus nationalen Regierungen und europäischen Institutionen, die zusammen für die Wohnungen sorgen, die sich die Menschen nicht leisten können, für Arbeitsplätze, Chancen, Sicherheit, die grüne Transformation und Hilfe für die Ukraine. Wird Europa aufwachen, bevor es zu spät ist“?
Einige „kleine“ gute Nachrichten zum Abschluss dieser Presseschau:
Die Wahlbeteiligung war die höchste der letzten 30 Jahre – nach vorläufigen Schätzungen 50,97 % – mit einem Spitzenwert von 89,9 % in Belgien, wo Wahlpflicht besteht, und einem Tiefstwert in Kroatien mit etwas mehr als 21 %.
Ilaria Salis, eine italienische linksextreme Aktivistin und Lehrerin, die in Budapest wegen eines Angriffs auf Neonazi-Aktivisten vor Gericht steht und sich nach einem Jahr im Gefängnis in Hausarrest befindet, wurde auf den Listen der Alleanza verdi e sinistra gewählt, die in Italien 6,8 % der Stimmen erhielt. Ihr Fall hatte einen Teil der italienischen Öffentlichkeit bewegt. Sobald ihre Wahl am 16. Juli verkündet wurde, kann sie nun Immunität beantragen, berichtet Internazionale.
Die befürchtete massive russische Einmischung in den europäischen Wahlprozess erreichte letztendlich wohl nicht den erwarteten Umfang. Sie nahm meist die Form von „Doppelgängern“ an – Posts, die die der offiziellen Medien nachahmen – wie die Website des schwedischen öffentlich-rechtlichen Fernsehens SVT erklärt. Sie stützt sich auf eine Analyse, die vom russischen Zentrum Bot Blocker vor allem in Frankreich und Deutschland durchgeführt wurde.
In Zusammenarbeit mit Display Europe, kofinanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind jedoch ausschließlich die des Autors/der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die der Europäischen Union oder der Generaldirektion Kommunikationsnetze, Inhalte und Technologie wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können für sie verantwortlich gemacht werden.

Schätzen Sie unsere Arbeit?
Dann helfen Sie uns, multilingualen europäischen Journalismus weiterhin frei zugänglich anbieten zu können. Ihre einmalige oder monatliche Spende garantiert die Unabhängigkeit unserer Redaktion. Danke!