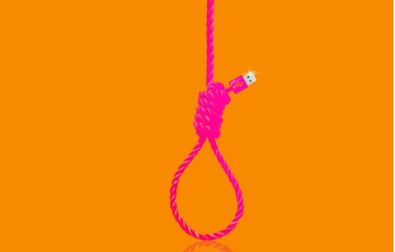Es ist der 24. April 2022. Emmanuel Macron wird mit 58,54 % gegen Marine Le Pen (Rassemblement National) für eine zweite Amtszeit wiedergewählt. Vor dem Champ-de-Mars in Paris erklärt der französische Präsident: „Viele unserer Landsleute haben heute für mich gestimmt, nicht um die Ideen zu unterstützen, die ich vertrete, sondern um der extremen Rechten einen Riegel vorzuschieben. Und ich möchte ihnen hier sagen, dass ich mir bewusst bin, dass diese Wahl mich für die kommenden Jahre dazu verpflichtet.“
Zwei Jahre später ist diese Abgrenzung Geschichte und die Partei von Marine le Pen, der Rassemblement National (RN), in den Wahlumfragen stärker denn je. „Der Rahmen hat sich sehr negativ weiterentwickelt“, beklagt Jean-Marie Fardeau, Leiter des Vereins VoxPublic, der Bürgerinitiativen unterstützt, sie begleitet und ihre Stimme an Entscheidungsträger weitergibt. „In den letzten Jahren sind rechtsextreme Ideen und Diskurse, wie die Themen Immigration und nationale Sicherheit, in der öffentlichen Debatte weiter in den Mittelpunkt gerückt und von verschiedenen Medien und Parteien übernommen und bedient worden.“
Schlimmer ist jedoch, dass die Regierung das Erstarken des Rassemblement National nicht nur nicht aufgehalten hat, sondern im Gegenteil sogar proaktiv Gesetze im Sinne der extremen Rechten einführte. So wurde z. B. das Einwanderungsgesetz am 26. Januar 2024 – trotz der Zensur eines Drittels der Artikel durch den Verfassungsrat – verabschiedet. Im Dezember 2023 prangerte die Rechtsverteidigerin Claire Hédon einen Gesetzentwurf an, der die „derzeit vorgesehenen Garantien zum Schutz der Grundrechte von Ausländern“ angreife und gegen den „Schutz der Rechte und Freiheiten“ verstöße.
„Das Einwanderungsgesetz stellt einen gravierenden Wendepunkt dar. Es ist zwar nichts Neues, dass die Rechte den rechtsextremen Wählern hinterherläuft, aber von einem Präsidenten, der zum Teil mit den Stimmen der Linken gewählt wurde, um die extreme Rechte abzuwehren, war dies etwas weniger zu erwarten“, bestätigt Jean-Marie Fardeau.
Zersplitterte Zivilgesellschaft
Vor diesem Hintergrund glaubt der auf Rechtsextremismus spezialisierte Politologe Jean-Yves Camus nicht mehr an die Möglichkeit einer allgemeinen, von der Zivilgesellschaft ausgehenden Mobilisierung. „Im antirassistischen Milieu gab es am Abend des zweiten Wahlgangs der Präsidentschaftswahlen 2002, als Jacques Chirac die Wahl mit 82 % der Stimmen gegen Jean-Marie Le Pen gewann, eine große Erleichterung. Viele Aktivisten hielten den Kampf für gewonnen, die extreme Rechte würde nie an die Macht kommen – ein Irrtum. In der Folge konzentrierten sich viele Menschen auf andere Themen und engagierten sich für die Umwelt oder in Gewerkschaften ... Dies war zwar 2023 bei der Mobilisierung gegen die Rentenreform oder für die Verteidigung der öffentlichen Krankenhäuser von Nutzen, aber für den Kampf gegen die Nationale Sammlungsbewegung eher weniger.“
Diese Sichtweise teilt auch Jean-Marie Fardeau: „Heute stellt man fest, dass die Bewegung nicht unumkehrbar war. Und dass Fortschritte, die in die richtige Richtung gingen, wieder rückgängig gemacht werden können, insbesondere was die Rechte von immigrierten und LGBTQUIA+-Personen angeht.“
„Seit nunmehr 15 Jahren wird die Gesellschaft auf einen sicherheitsorientierten, autoritären und angstbesetzten Diskurs konditioniert, der mit einem sehr liberalen Wirtschaftssystem verbunden ist, das Ungleichheiten verstärkt und wenig Hoffnung macht“ – Jean-Marie Fardeau, VoxPublic
In der französischen Gesellschaft mangelt es jedoch nicht an Bürgerbewegungen, Kollektiven und Vereinen. „Die großen Netzwerke sind noch sehr aktiv, und sie werden durch eine Vielzahl neuer, vielversprechender Initiativen ergänzt, die ihre Aktionsformen immer wieder erneuern. Dies gilt z. B. für die feministische und die Umweltbewegung. Das Problem liegt also nicht im Mangel an Initiativen, sondern in der Schwierigkeit, ein völlig ungünstiges Kräfteverhältnis umzukehren. Seit nunmehr 15 Jahren wird die Gesellschaft auf einen sicherheitsorientierten, autoritären und angstbesetzten Diskurs konditioniert, der mit einem sehr liberalen Wirtschaftssystem verbunden ist, das Ungleichheiten verstärkt und wenig Hoffnung macht“, so der nationale Sprecher von VoxPublic.
Klima der Unterdrückung sozialer Bewegungen
Die Mobilisierung der Zivilgesellschaft wird zudem stark durch ein allgemeines Klima der Repression und der Einschränkung des demokratischen Raums behindert. „Für Vereine, die die etablierte Ordnung in Frage stellen, wird es immer schwieriger, sich Gehör zu verschaffen. Ob es sich nun um Umweltfragen mit der Mobilisierung gegen die Mega-Becken oder die Autobahn A69 handelt – ein Projekt, das Toulouse mit Castres verbinden soll und wegen seiner Umweltauswirkungen viel Kritik hervorruft –, um die Verteidigung der Rechte von Ausländern oder die Unterstützung der Bewohner von Gaza – dies alles sind starke Angriffe auf die öffentlichen Freiheiten und das Demonstrationsrecht.“
Ein Ausdruck dieses Trends ist das im Mai 2021 verabschiedete Gesetz für „umfassende Sicherheit unter Wahrung der Freiheitsrechte“. Es wurde von der französischen Regierung angekündigt als Schaffung eines „Kontinuums der Sicherheit“ durch mehr Befugnisse für kommunale Polizeibeamte und den erleichterten Einsatz technischer Mittel (Drohnen, Fußgängerkameras, Videoüberwachung). Der Verfassungsrat zensierte jedoch mehrere Bestimmungen, die Grundrechte eingeschränkt hätten. So wurde der Straftatbestand der „Provokation der Identifizierung der Ordnungskräfte“, der in Frankreich Hunderttausende von Menschen zu Demonstrationen veranlasst hatte, ebenso abgeschafft wie der allgemeine Einsatz von Drohnen.
Ein weiteres Gesetz, das die soziale Bewegung stark beeinflusste, war das sogenannte „Separatismusgesetz“. Viele Juristen schätzten es als das sicherste Gesetz der fünfjährigen Amtszeit Macrons ein. Dieses erweiterte insbesondere die Möglichkeiten zur administrativen Auflösung von Vereinen. Seit 2021 sieht das Gesetz nun vor, dass die Regierung alle Vereinigungen oder faktischen Gruppierungen auflösen kann, „die zu gewalttätigen Handlungen gegen Personen oder Güter aufrufen.“ Mit dieser Begründung wird im Juni 2023 die Auflösung der Umweltbewegung Les Soulèvements de la Terre gerechtfertigt – ein Novum in der Geschichte der Fünften Republik. Der Staatsrat hob diese Auflösung jedoch auf.
Schließlich schlug sich dieser politische Wille auch in dem Versuch nieder, eine der symbolträchtigsten Vereinigungen Frankreichs, die 1898 gegründete Liga für Menschenrechte (Ligue des droits de l’homme, LDH), mundtot zu machen. Im April 2023 hatte die Regierung bestimmte „Stellungnahmen“ der LDH in Frage gestellt, nachdem sie Bürgerbeobachter eingesetzt hatte, um die Ordnungsmaßnahmen bei streng bewachten und unterdrückten Demonstrationen in Sainte-Soline zu dokumentieren. Innenminister Gérald Darmanin hatte erklärt, dass er die Subventionen, die der LDH vom Staat gewährt wurden, in Frage stelle.
Den Kulturkampf zurückgewinnen
Die Verbindung zu den politischen Parteien soll auch dazu dienen, die von der Zivilgesellschaft eingebrachten Ideen weiterzugeben. „Es ist bekannt, dass die Abgeordneten sehr genau darauf achten, welche Diskurse und Vorschläge das Vereinswesen hervorbringt. Es gibt eine Durchlässigkeit, insbesondere zu den linken Parteien. Aber man spürt, dass Vereinigungen immer weniger Hoffnung darin setzen, von den Parteien gehört zu werden, da diese zu sehr mit ihrer eigenen Wahlstrategie beschäftigt sind. Außerdem gibt es noch die Angst der Zivilgesellschaft, parteiisch zu erscheinen und vereinnahmt zu werden“, erklärt Jean-Marie Fardeau.
Ganz zu schweigen von der Delegitimierung des Mittelbaus, die in den letzten Jahren durch zahlreiche Gesetze zur Zerschlagung sozialer und gewerkschaftlicher Instanzen verstärkt wurde, angefangen mit den „Macron-Verordnungen“ ab 2017, die die Modalitäten für Verhandlungen in Unternehmen ohne Gewerkschaftsvertreter lockerten.
„Wir, die in diesem Milieu tätig sind, sehen, wie es organisiert ist. Wir tun, was wir können, aber diese Dampfwalze ist schwer aufzuhalten und es gelingt uns nicht immer, uns gegen die gesetzgeberischen Instrumente zu wehren. Im Jahr 2020 wurde das Kollektiv gegen Islamophobie in Frankreich (Collectif contre l'islamophobie en France, CCIF) einfach aufgelöst – eine Katastrophe für muslimische Menschen. Da werden Verfahren durchlaufen, die man danach schwer rückgängig machen kann. Wir müssen also auf einen Kulturkampf vorbereitet sein, der Jahre dauern wird“, schloss der Sprecher von VoxPublic.
Mit freundlicher Unterstützung der Heinrich-Böll-Stiftung EU
Sie konnten diesen Artikel in voller Länge lesen.
Möchten Sie unsere Arbeit unterstützen? Voxeurop ist auf die Abonnements und Spenden seiner Leserschaft angewiesen.
Informieren Sie sich über unsere Angebote ab 6 € pro Monat und die exklusiven Vorteile für unsere Abonnierenden.
Abonnieren
Oder stärken Sie unsere Unabhängigkeit mit einer Spende.
Spenden