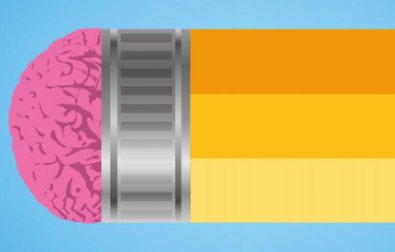Neben der Schnellstraße R107 im Kosovo, in einer Landschaft aus Autowaschanlagen und Marmorläden, in der es nach Essig riecht, liegt die Zukunft in einer Genossenschaft für Ajvar, einer Sauce aus gerösteten roten Paprikaschoten. Diese Konservenfabrik befindet sich in Krushë e Madhe, einem Bauerndorf im Westen des Kosovo, und wurde von Fahrije Hoti und anderen Witwen wie ihr mit Unterstützung verschiedener internationaler Organisationen gegründet.
Mit über 140 Kriegswitwen in einer Gemeinde mit nur 3.000 Einwohnenden ist der Ort als das Dorf der Kriegswitwen bekannt.
Drei schwarz gekleidete Frauen, eine davon am Steuer, steigen wenige Meter von der Fabrik entfernt aus einem Auto. Sie erklären, dass es im Dorf viele Witwen gibt, „und auch im Nachbardorf“. Zwischen Februar 1998 und Dezember 2000 wurden im Kosovo-Krieg über 13.000 Menschen getötet oder sind verschwunden, als sich der ethnische Konflikt zwischen Serben und Kosovo-Albanerinnen und -Albanern in der letzten Phase des Zerfalls Jugoslawiens verschärfte.
Davon waren laut Angaben des Zentrums für Menschenrechte im Kosovo mehr als 10.000 Albaner*innen aus dem Kosovo, etwa 2.000 Serbinnen und Serben und der Rest Roma und Bosnier*innen. Sexuelle Gewalt wurde in großem Umfang als Kriegswaffe eingesetzt. Was hätte man mehr für die Überlebenden tun können, und welche Lehren lassen sich daraus für andere aktuelle Konflikte ziehen?
Prekarität, Traumata und Vorurteile
„Wir haben so viel durchgemacht, und ich bin mit sieben Waisenkindern allein geblieben“, sagt Meradije Ramadani, die in Krushë e Madhe lebt, mit zitternder Stimme. „Dann mussten wir fliehen, wegen der serbischen Besatzung, die uns, unsere Häuser und alles, was wir hatten, zerstört hat“, empört sie sich. „Gott sei Dank hat Albanien uns seine Türen geöffnet“, fährt sie fort. „Dann sind wir zurückgekehrt.“
Es ist nun 26 Jahre her, seit Meradije Ramadanis Ehemann getötet wurde, und 25 Jahre, seit sie in den Kosovo zurückgekehrt ist: „Als wir zurückkamen, stand kein einziges Gebäude mehr, alles war dem Erdboden gleichgemacht, verbrannt, zu Asche geworden, völlig zerstört“, erinnert sie sich. In diesem ersten Jahr, erzählt sie, schliefen sie im Freien, „in Zelten, unter Plastikplanen, wir hatten kein Zuhause“. Trotzdem schickte Ramadani ihre Kinder weiterhin zur Schule: „Sowohl mein Mann als auch ich wollten immer, dass sie lernen und etwas aus sich machen“, betont sie. Heute sagt sie, dass sie stolz ist: „Sie haben studiert, geheiratet und heute bin ich Großmutter von 17 Enkelkindern“, sagt sie. „Und alle meine sieben Kinder haben einen Job.“

In der Nacht vom 24. März 1999 startete die NATO eine Reihe von Bombenangriffen gegen serbische Streitkräfte. Es war das erste Mal, dass sie dies ohne UN-Mandat und unter Beteiligung deutscher Soldaten tat. Am nächsten Tag, am Nachmittag des 25. März 1999, marschierten Paramilitärs und die serbische Besatzungsarmee in Krushë e Madhe ein und verschleppten die Männer als Vergeltungsmaßnahme.
„Maestro, maestro, maestro ...“, rezitiert Irfon Ramadani und zeigt nacheinander auf die Porträts, die im Museum des Massakers von Krushë e Madhe ausgestellt sind. Ramadani war zum Zeitpunkt des Massakers acht Jahre alt: „Sie trennten die Frauen auf der einen Seite und die Männer und Kinder auf der anderen Seite und brachten sie weg“, erinnert er sich, während er durch das Museum geht, in dem er jetzt als Führer arbeitet. In den Vitrinen befinden sich Briefe, Kleidung, Brillen und Bücher der ermordeten Einwohnenden.
Und ein mit Schlamm verschmierter Rucksack. „Selbst in Kriegszeiten trennte er sich nie von seinem Rucksack und seinen Büchern“, lautet die Bildunterschrift, die die Worte der Mutter eines 17-jährigen Jungen wiedergibt, der Arzt werden wollte.Im Sommer 1999 kehrte Hoti allein in das zerstörte Dorf zurück, mit ihren beiden Kindern, der dreijährigen Sabina und dem Säugling Drilon. Es gab viele Frauen in derselben Situation, die sich einer doppelten Herausforderung stellen mussten.
Einerseits trauerte sie um ihren verstorbenen Ehemann, andererseits sah sie sich mit gesellschaftlichen Vorurteilen konfrontiert, weil sie den Platz eingenommen hatte, der Männern vorbehalten war. Hoti begann, Ajvar und Honig zu verkaufen, und schloss sich mit anderen Frauen zusammen. Heute beschäftigt ihre Genossenschaft mehr als 60 Witwen, und ihre Geschichte wurde mit dem Film Hive (Bienenstock) verfilmt.
Die meisten von ihnen haben es jedoch nicht geschafft, ein Unternehmen zu gründen.
„Das Leben war extrem hart, vor allem für Witwen, die sich oft über die Heuchelei der Gesellschaft beklagten: Einerseits wurden sie auf ein Podest gestellt, als Witwen von Märtyrern gefeiert und als Verantwortliche für die Erziehung der nächsten Generation angesehen, andererseits erhielten sie jedoch nur sehr wenig Unterstützung“, erinnert sich Professorin Hanna Kienzler, Anthropologin und Co-Direktorin des ESRC Centre for Society and Mental Health am King's College London, gegenüber El Confidencial.
Sie zog zwischen 2007 und 2009 nach Krushë e Madhe, um die Auswirkungen des Krieges auf die psychische Gesundheit von Frauen zu untersuchen, die extreme Grausamkeiten überlebt hatten.

Seitdem kehrt Kienzler jedes Jahr in das Dorf zurück, „außer während der Pandemie“, wie sie präzisiert. Kienzler gibt an, dass die Hinterbliebenenrente damals 62 Euro betrug. „Weißt du, was man in Kosovo für diesen Betrag kaufen kann? Eine Flasche Speiseöl kostet 2 Euro und eine Hose genauso viel wie in Deutschland oder anderswo: Rechne selbst“, empört sie sich.
Mit diesem Betrag mussten die Witwen für die Ausbildung ihrer Kinder aufkommen und oft auch für andere abhängige Personen sorgen. „Das verursachte wiederum enormen Stress“, erklärt sie. Im Jahr 2014 führte die kosovarische Regierung ein Entschädigungssystem für verschiedene vom Krieg betroffene Personengruppen ein, das im Jahr 2025 erhöht wurde.
Zu der Unsicherheit und dem Trauma kamen noch gesellschaftliche Erwartungen hinzu: „Die Mütter oder ihre Kinder mussten lernen, den Traktor zu fahren, und nach der Ernte konnten die Frauen ihre Produkte nicht selbst auf dem Markt verkaufen, weil das damals einfach nicht üblich war“, erinnert sich Kienzler. „Deshalb mussten sie oft Verwandte oder Nachbarn beauftragen, ihre Paprika zu verkaufen“, fügt sie hinzu.
Die meisten von ihnen konnten nicht einmal alleine leben. Einige Frauen mussten sogar ihre Kinder aufgeben. Für die Albaner*innen im Kosovo wie auch für andere Völker auf dem Balkan und im Südkaukasus ist die Familie „patrilokal“, d. h. wenn ein Paar heiratet, wird erwartet, dass Mann und Frau in das Haus der Eltern des Mannes ziehen, und die Nachkommen werden als zur Familie des Vaters gehörig betrachtet. Dadurch ist das System „nach der männlichen Linie organisiert“, und männliche Kinder sind notwendig, um die Nachkommenschaft fortzuführen, erklärt ein Bericht der Vereinten Nationen und World Vision.
So mussten einige Witwen zu ihren Eltern zurückkehren, während ihre Kinder von ihren Schwiegermüttern und Schwägerinnen großgezogen wurden. Flora, die mit 24 Jahren Witwe wurde, erzählte Balkan Insight, dass sie von der Familie ihres Mannes gezwungen wurde, ohne ihre Tochter – die sie als ihre Tante ansah – zu ihren Eltern zurückzukehren.
„Wenn eine Frau Witwe wurde und zu ihren Eltern zurückkehren wollte, musste sie in den meisten Fällen ihre Kinder zurücklassen, sodass viele Witwen weiterhin bei ihren Schwiegereltern lebten“, erklärt Kienzler. Und während es für Witwer normal war, schnell eine neue Partnerin zu finden, war es für Witwen nach wie vor tabu, wieder zu heiraten. Im Jahr 2010 gab es im Kosovo 5.052 Kriegswitwen, von denen nur 20 (0,4 Prozent) ihr Recht auf Hinterbliebenenrente verloren hatten, weil sie wieder geheiratet hatten.

Aus diesem Grund und weil die meisten von ihnen keine langfristige finanzielle Unterstützung hatten, gelang es nur sehr wenigen, sich ein eigenes Geschäft aufzubauen, „aber das bedeutet nicht, dass sie nicht unglaublich stark waren“, sagt die Anthropologin, die während des Videoanrufs Tränen in den Augen hat. Wie viele andere Frauen, so sagt sie, habe Ramadani es geschafft, ihre sechs Töchter zur Universität zu schicken, „auch wenn viele Dorfbewohnende sie anfangs nicht unterstützt haben“.
„Man muss darüber sprechen, um das Stigma zu beenden“
Während sie gegen die gesellschaftlichen Erwartungen ankämpften, wurden sie innerlich von Scham, Leid und Erinnerungen zerfressen. Über das Trauma zu sprechen, war nicht einfach. In ihrer Forschung bezeichnet Kienzler dies als „die Sprache der Symptome“ und verweist darauf, dass es manchmal so erschütternd war, anderen Frauen von diesen Schrecken zu erzählen, dass es ausreichte zu sagen: „Sobald ich mich daran erinnere, bekomme ich Kopfschmerzen, Bauchschmerzen“, damit die anderen verstanden, wovon sie sprachen, da sie alle ähnliche Erfahrungen gemacht hatten.
Vasfije Krasniqi war 16 Jahre alt, als sie am 14. April 1999 von einem serbischen Polizisten entführt, in ein anderes Dorf gebracht, gefoltert und von mehreren Männern vergewaltigt wurde. Sie sagt, dass dieses Ereignis ihr Leben für immer verändert hat. Krasniqi war eine der ersten Personen, die den Mut hatte, öffentlich zuzugeben, dass sie während des Krieges sexuell missbraucht worden war: „Ich möchte, dass die Welt versteht, dass verspätete Gerechtigkeit keine Gerechtigkeit ist“, sagt sie kategorisch.
Sie betont, dass Überlebende sexueller Gewalt in Kriegszeiten „sofortige und langfristige Unterstützung brauchen und nicht jahrzehntelanges Schweigen“, und erinnert daran, dass Regierungen schnell handeln müssen, um die Opfer anzuerkennen, den Schutz der psychischen Gesundheit zu fördern und die Verantwortlichen vor Gericht zu stellen.
Krasniqi ist der Meinung, dass die Gesellschaft ihre Sichtweise auf Überlebende ändern muss: „Wir dürfen niemanden bemitleiden und tragen kein Stigma der Schande, wir sind Zeugen der Geschichte und unser Mut kann dazu beitragen, künftige Gräueltaten zu verhindern.“ „Wenn meine Geschichte also etwas lehrt, dann ist es, dass Wahrheit und Würde mächtige Formen der Gerechtigkeit sind und dass Schweigen nur die Verantwortlichen schützt, niemals die Überlebenden“, fügt sie hinzu.
Fast zwanzig Jahre nach Kriegsende, im Februar 2018, haben die kosovarischen Behörden eine Rente in Höhe von 230 Euro für Überlebende sexueller Gewalt festgelegt. Aufgrund des mit diesem Status verbundenen Stigmas hatten jedoch bis 2023 nur 1.870 Personen eine Entschädigung beantragt. Schätzungen zufolge wurden etwa 20.000 Frauen und Männer Opfer sexueller Gewalt, die als Kriegswaffe eingesetzt wurde.
Witwen und Migrierende von heute auf morgen
Auf der anderen Seite des Konflikts flohen Schätzungen zufolge im Jahr 1999 etwa 200.000 Zivilistinnen und Zivilisten serbischer und Roma-Ethnie aus dem Kosovo nach Serbien. Ein Bericht von Human Rights Watch vom August 1999 beschrieb die „ Welle von Entführungen und Morden an Serbinnen und Serben“ seit Mitte Juni desselben Jahres, darunter das Massaker an 14 serbischen Bauern als Vergeltung für die Gräueltaten der serbischen Sicherheitskräfte vor dem Eintreffen der NATO. Viele der Vertriebenen waren Frauen.
„Diese Frauen wurden von einem Tag auf den anderen zu Witwen und mussten sofort nach Serbien fliehen, um Schutz für sich und ihre Familien – Kinder, Eltern, Verwandte – zu suchen. Zur Witwenschaft kam also noch die Auswanderung in das Herkunftsland ihrer ethnischen Gruppe hinzu, wo sie in vielen Fällen nicht gut aufgenommen wurden“, erklärt die serbische Soziologin Mirjana Bobić, Mitautorin der Studie „Über Witwen oder über eine soziale Ungerechtigkeit“ (2020). Die migrierten Kriegswitwen übernahmen die wirtschaftliche Versorgung ihrer Familien und „arbeiteten oft im Handel, im Reinigungssektor, in Tischlereien, Bars und Konditoreien“, erklärt Bobić. Einige waren auch krank.
Da also „vom Staat keine wirkliche Unterstützung kam, waren die meisten von ihnen auf Verwandte, Freundinnen und Freunde angewiesen, die mit ihnen geflohen waren“, erklärt die serbische Soziologin. Der Staat war nicht darauf vorbereitet, in so kurzer Zeit so viele Geflüchtete aus Kroatien und Bosnien-Herzegowina aufzunehmen: laut der vom UNHCR durchgeführten Geflüchtetenzählung waren es über 600.000.
Außerdem konnten diejenigen, die nicht arbeiteten, vor dem 45. Lebensjahr nicht mit einer Rente des serbischen Staates rechnen. Daher waren die einzigen Einkünfte Beihilfen oder Gelder, die den Kindern gewährt wurden, sofern sie nachweisen konnten, dass ihr Vater im Krieg gestorben oder verschwunden war, erklärt Bobić.
Und „das bedeutete, in die Gebiete zurückzukehren, die sie verlassen hatten, nach den Überresten der Leichen zu suchen und die Beweise vorzulegen“.
Der Kontext ändert sich, aber in jeder Nachkriegszeit sind soziale, wirtschaftliche und psychologische Unterstützungsmechanismen unerlässlich, um sowohl das Trauma als auch die Unsicherheit zu bewältigen. Allein in der Ukraine gibt es Schätzungen zufolge bereits Zehntausende Kriegswitwen.
👉 Originalartikel auf El Confidencial
🤝 Dieser Artikel wurde im Rahmen des Projekts PULSE erstellt, einer europäischen Initiative zur Förderung der internationalen journalistischen Zusammenarbeit. Nicole Corritore (Obct) hat zu seiner Erstellung beigetragen
Schätzen Sie unsere Arbeit?
Dann helfen Sie uns, multilingualen europäischen Journalismus weiterhin frei zugänglich anbieten zu können. Ihre einmalige oder monatliche Spende garantiert die Unabhängigkeit unserer Redaktion. Danke!