Georgij ist 28 Jahre alt, sieht aber jünger aus. Er lächelt höflich und spricht ein stockendes, aber verständliches Französisch. Ich treffe Georgij und seinen Partner Sergej, 30, an einem Nachmittag im April. Sie sind mit Hilfe von Russie-Libertés nach Frankreich gekommen, eine Initiative, die sich zusammen mit anderen wie inTransit in Deutschland für die Unterstützung der russischen Opposition einsetzt.
Georgij ist ein Oberleutnant in der russischen Armee, in die er im Jahr 2017 eintrat. Nach seinem Abschluss am Moskauer Institut für Physik und Technologie wurde er zum Militärdienst bei den Streitkräften einberufen. Während dieser Zeit praktizierte er weiterhin Programmierung, für die er ausgebildet worden war.
Seine Familie unterstützte ihn: Dies könnte der Beginn einer militärischen Karriere sein, gleichbedeutend mit einem sicheren Posten und einem verlässlichen Gehalt. Außerdem hatte die Arbeit in der IT-Abteilung des Militärs viele praktische Vorteile: ein Bürojob, keine Einsätze am Gefechtsfeld und kein Gebrauch von Waffen zum Beispiel.
Im folgenden Jahr, am Ende seines Wehrdienstes, bot die Armee Georgij einen Fünfjahresvertrag an, „mit dem Versprechen, dass sich an meinen Aufgaben nichts ändern würde“. Wenig später wurde ihm jedoch mitgeteilt, dass die Stelle, für die er eingestellt worden war, nicht mehr existierte, dass er anderswo eingesetzt werden würde und dass eine vorzeitige Beendigung seines Vertrags ohnehin nicht möglich sei.
Zu diesem Zeitpunkt begannen die Konflikte mit seinen Vorgesetzten, auch über Kleinigkeiten. Und dann war da noch die Tatsache, dass Georgij schwul ist, was in einem Land, in dem Homophobie zur Staatspolitik gehört, ein schweres Stigma darstellt. Das erste russische Gesetz gegen „LGBT+-Propaganda“ wurde 2013 verabschiedet und 2022 verschärft, was schwerwiegende Folgen für Schwulenrechtsaktivistinnen, -aktivisten und -verbände hatte. „Schon damals“, so Georgij, „war ich mit der Innenpolitik des Landes und den Werten der Armee, in der es Pflicht ist, den Staat zu unterstützen, nicht einverstanden“.
Im Jahr 2021 wurde sein erstes offizielles Rücktrittsschreiben mit der Begründung abgelehnt, es sei „unmöglich, die Armee vor Ablauf seines Vertrags zu verlassen“. Weitere Briefe, Dokumente und Berichte folgten. Meine sämtlichen Anträge wurden ignoriert“, erklärt Georgij. Dann versuchte er es mit Fernbleiben vom Dienst und erhielt sogar den Beweis, dass er nicht in der Lage war, seine Aufgaben weiter wahrzunehmen – in Form eines Attests eines Psychiaters, der bei ihm Depressionen diagnostizierte. Aber es gab einfach keine Lösung.
Nach einiger Zeit wurde er vorgeladen. Es gab in der Tat eine Möglichkeit für ihn, die Armee zu verlassen: ein Gerichtsverfahren, ein Prozess. Ein Dossier mit seinem Namen, in dem er des Diebstahls und der Korruption beschuldigt wurde, war sogar schon vorbereitet worden. Der Austritt aus der Armee war also möglich, aber der einzige Ausweg führte ins Gefängnis. Es gab keine Lösung.
Eine große Veränderung trat am 24. Februar 2022 ein, als die umfassende Invasion der Ukraine begann. „Diesen Morgen werde ich nie vergessen: Ich saß in der U-Bahn und sah auf meinem Handy die Bombardierung der Ukraine“. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Georgij nicht mitbekommen, was vor sich ging: Seine Depression wurde immer schlimmer. „Am nächsten Tag gab es in Moskau eine Demonstration gegen den Krieg.“ Obwohl ihm dies aufgrund seines militärischen Status untersagt war, nahm er an der Demonstration teil, „um zu zeigen, dass die Kriegsgegner*innen nicht allein sind“. An den darauf folgenden Frühling kann sich Georgij nicht mehr erinnern. „Ich hatte angefangen, viel zu trinken; ich war zum Alkoholiker geworden“.
„Ich müsste einen Weg finden, aus der Armee auszutreten, denn es stand außer Frage, dass ich mich an all dem beteiligen würde“ – Georgy
Im Juni desselben Jahres wurde er mit der Arbeit an den Akten der Freiwilligen für den Krieg in der Ukraine beauftragt, was ihm Zugang zu den Daten derjenigen verschaffte, die sich aus freien Stücken zum Militärdienst gemeldet hatten. Die Diskrepanz zwischen den Zahlen, die er vor Augen hatte, und denen, die der politische Diskurs suggerierte, war unübersehbar. „Ich erkannte, dass nicht nur meine Freundinnen, Freunde und Bekannten gegen den Krieg und die Politik des Landes waren, sondern auch, dass die offiziellen Zahlen aufgebläht waren.“
Die russischen Streitkräfte rekrutieren sich im Wesentlichen aus vier Quellen. Die erste ist die Wehrpflicht: die Männer sind verpflichtet, ein Jahr Militärdienst zu leisten. Die zweite Gruppe besteht aus „Vertragssoldatinnen und -soldaten“, die sich durch Unterzeichnung eines Vertrags mit dem Verteidigungsministerium zur Teilnahme verpflichtet haben. Dann gibt es die Personen, die durch den Erlass von Wladimir Putin vom 21. September 2022 zum Kampf in der Ukraine mobilisiert wurden. Und schließlich gibt es die „Freiwilligen“, d.h. die Menschen, die sich freiwillig bereit erklärt haben, am Krieg teilzunehmen, und zwar über Freiwilligenorganisationen, die dem Verteidigungsministerium angegliedert sind, einschließlich privater Militärfirmen. Das geht aus der Analyse von Yuri Fedorov, einem Experten für militärische und politische Fragen in Russland für das Französische Institut für Internationale Beziehungen (IFRI) und in der Tschechischen Republik ansässiger Journalist, hervor.
Georgij sprach mit mir über genau diesen Erlass Putins. In ihm wurde auch festgelegt, dass für diejenigen, die bereits einen Vertrag mit der Armee hatten, dieser „bis zum Ende des Krieges“ verlängert wird. Zu diesem Zeitpunkt, erklärt er, „verstand ich, dass ich nur sehr wenige Möglichkeiten hatte. Ich wusste, dass es nur zwei Optionen gab: entweder Krieg oder Gefängnis“.
Anna Colin-Lebedev ist Dozentin und Forscherin im Bereich Politikwissenschaft. Ihre Arbeit konzentriert sich auf das Verhältnis zwischen Bürgerinnen, Bürgern und Staat in der postsowjetischen Gesellschaft. Nach dem Einmarsch in die Ukraine veröffentlichte sie Jamais frères? („Niemals Brüder?“, Seuil, 2022), eine Analyse der Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen der russischen und der ukrainischen Gesellschaft.
Colin-Lebedev sprach mit mir über die heikle und schmerzhafte Frage der Wehrpflichtigen, also der jungen Menschen, die zum Militärdienst verpflichtet werden. Das Gesetz erlaubt die Entsendung dieser Männer an die Front, obwohl dies für den Kreml ein Tabu bleibt – dank der Kampagnen von Soldatenmüttern in Russland, insbesondere während des ersten Tschetschenienkriegs. Ein Erlass von Boris Jelzin, der diese Praxis verbot, wurde später wieder aufgehoben.
Um in den Krieg geschickt zu werden, sind diese jungen Männer nicht mehr „Wehrpflichtige“, sondern „Soldaten“. Was bedeutet das genau? „Sie sind 18 Jahre alt und erhalten die Einberufung zu ihrem einjährigen Militärdienst. Früher hat es mindestens vier Monate gedauert, bis man aufgefordert wurde, einen Vertrag zu unterschreiben. Jetzt geschieht das am ersten Tag“, erklärt Colin-Lebedev. „Es handelt sich um junge Leute, die noch nie eine Waffe in der Hand hatten“. Mit der Unterzeichnung eines Vertrags sind sie nun Angestellte des Verteidigungsministeriums mit einem unbefristeten Vertrag, d.h. bis zum Ende des Krieges. Damit ändert sich der Status dieser Männer von Wehrpflichtigen zu ‚Vertragssoldaten‘: Wie von Zauberhand gibt es nun keine Wehrpflichtigen mehr an der Front.
Oder aber, so Colin-Lebedev weiter, sie werden „in die Grenzregionen, nach Cherson oder Saporischschja“ geschickt. Da die Regierung diese Gebiete als „zu Russland gehörig“ betrachtet, verlassen die jungen Menschen offiziell nie das Staatsgebiet, obwohl sie in Wirklichkeit an der Front kämpfen und sterben.
Es handelt sich um eine besonders gefährdete Bevölkerungsgruppe, sagt Colin-Lebedev. Zum einen gibt es den Druck der Gesellschaft und der Familie, der besagt, dass ein Mann in der Armee zu dienen hat. Darüber hinaus handelt es sich um 18-Jährige, die noch nie für ein richtiges Gehalt gearbeitet haben, und denen nun plötzlich die Möglichkeit geboten wird, viel Geld zu verdienen. Sie haben auch „keine Möglichkeit, mit Anwältinnen und Anwälten oder ihren Angehörigen zu kommunizieren. Und die Beamtinnen und Beamten üben großen Druck aus. Das bedeutet, dass es sich nicht um Menschen handelt, die in der Armee dienen wollen, sondern vielmehr, dass sie keine Möglichkeit haben, nicht zu dienen“.
Die Armee konzentriert ihre Rekrutierungsbemühungen auf die am stärksten benachteiligten Bevölkerungsschichten, fügt Colin-Lebedev hinzu. „Zunächst einmal ist man als Student für die Dauer des Studiums vom Dienst befreit. Diejenigen, die mit 18 Jahren beim Militär landen, sind Menschen, die keine höhere Ausbildung absolvieren. Die Armee rekrutiert vor allem in Kleinstädten, wo es schwieriger ist, sich zu verstecken, und je ärmer man ist, desto geringer ist die Chance, Militärpersonal zu bestechen oder ein ärztliches Attest zu kaufen. Und für ärmere Familien wird die Armee immer noch als Ausweg aus der Armut gesehen“.
Krieg oder Gefängnis. Oder Exil
Für Georgij ging alles sehr schnell: „Wenige Tage nach [der umfassenden Invasion] erhielt ich den Befehl, meinen Posten in der Verwaltung zu verlassen und mich bei der Sammelstelle zu melden, von wo aus ich für wer weiß wie lange an einen unbekannten Ort entsendet werden würde.“ Was konnte ich tun? Entweder Krieg, Gefängnis oder „ich müsste einen Weg finden, aus der Armee auszutreten, denn es stand außer Frage, dass ich mich an all dem beteiligen würde“.
Am Ende entschied er sich für das Exil. „Ich ging zu Sergej, um ihn zu warnen, dass ich weggehen würde. Ich war sicher, dass ich ihn nie wiedersehen würde“, sagt Georgij und wendet sich an seinen Partner, der neben ihm sitzt. Georgij nahm einen Zug nach Sibirien, dann half ihm ein Taxifahrer, mit dem er in Kontakt gebracht worden war, über die kasachische Grenze. Drei Tage später kam er in Kasachstan an. Von dort aus informierte er Sergej, der seinen Job als Geschichtsprofessor und sein Leben in Russland aufgab, um ihm zu folgen.
Kasachstan ist ebenso wie Armenien, Kirgisistan und Belarus ein Land, das dem Kreml politisch nahe steht, und Russinnen und Russen benötigen für die Einreise nur einen Inlandspass (das Äquivalent zu unserem Personalausweis). In vielen Fällen haben die Soldatinnen und Soldaten keine internationalen Pässe, denn diese werden bei ihrem Eintritt in die Armee eingezogen. Um das Land zu verlassen, müssen sie die Genehmigung ihrer Vorgesetzten und/oder des Geheimdienstes einholen.
Kasachstan ist also kein sicherer Ort für russische Soldatinnen und Soldaten, die desertiert sind. Georgij hatte auch keine Kontakte. Am Tag seiner Ankunft waren in den Hotels und Herbergen keine Betten frei, also fragte er das Mädchen im Kiosk, wo er eine Sim-Karte kaufte, nach Informationen. Sie bot ihm an, ihn bei sich aufzunehmen, vielleicht weil sie seine Situation verstand. „Es war wunderbar, überraschend und bewegend“, sagt er mit einem Lächeln.
Anfangs sagte Georgij nicht, dass er ein Deserteur sei – was ein Haftgrund ist –, sondern dass er der Mobilisierung entkommen sei und Arbeit in einer Fabrik gefunden habe. Im darauffolgenden Januar stattete die Polizei ihrer Wohnung einen Besuch ab, erzählt Georgij. „Wir dachten daran, über den Balkon im dritten Stock zu fliehen“, fügt Sergej lachend hinzu. In der Zwischenzeit mussten Lösungen gefunden werden. Sergej verbrachte seine Tage damit, sich bei Verbänden und NRO zu erkundigen, wie man sich in Sicherheit bringen konnte und was zu tun war.
Abschied von den Waffen: Wie man desertiert
Im Mai 2023 wurden sie in das Internationale Büro für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in Kasachstan (KIBHR) eingeladen, wo sie Aleksandr trafen, der inzwischen zu unserem Treffen gekommen ist und neben Sergej sitzt. Aleksandr ist 26 Jahre alt und ist – war – Leutnant in der russischen Armee.
„Als ich 18 Jahre alt war, trat ich in die Militärakademie ein, und die Politik begann mich persönlich zu beeinflussen.“ Aleksandr nennt mehrere Beispiele: „Wir arbeiteten in der Küche und das Verfalldatum des Fleisches, das wir aßen, war 1990. Warum haben wir Produkte gegessen, die schon so lange abgelaufen waren?“ Oder, so fährt er fort, „als ich vom Gehalt unserer Lehrer erfuhr, die zwischen 15 und 17 Tausend Rubel, also 150-170 Euro, verdienten. Wie konnte unsere Ausbildung gut sein, wenn sie so wenig verdienen? Man fragt sich also, wohin all das Geld fließt, das für unsere Akademie bereitgestellt wird. Und so fängt man an, sich Fragen zu stellen. Und auf YouTube fand ich Antworten: Ich schaute mir vor allem die Kanäle der russischen Opposition an. Da fing ich an zu glauben, dass es möglich ist.“
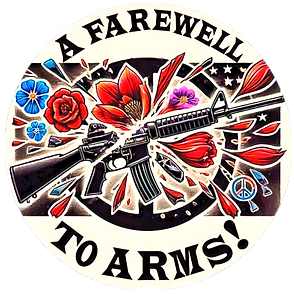
Zusammen mit anderen, die sie beim KIBHR trafen, begannen Sergej, Georgij und Aleksandr zu diskutieren, was sie politisch tun könnten. Aleksandr und Sergej hatten die Idee, ein Medienprojekt ins Leben zu rufen, das sich speziell an Soldatinnen und Soldaten richtet, um ihre Geschichte zu erzählen und ihnen zu zeigen, dass es möglich ist, die Armee zu verlassen. Eine Art „Gegenpropaganda für die Desertion“, erklären sie mir. Das Projekt heißt „A Farewell To Arms/Прощай, оружие“.
„Wir konnten nicht schweigen, es musste etwas getan werden. Für uns ist es wichtig, den Menschen, die die Armee verlassen, eine Stimme zu geben und diejenigen, die Zweifel haben, zu ermutigen, die Armee zu verlassen“, sagt Aleksandr. „Es ist eigentlich ganz einfach. Wir sind, was wir konsumieren, was wir essen, aber auch, was wir hören und sehen. Und das ist die Macht der Propaganda“. Sergej zufolge „ist es für Soldatinnen und Soldaten leichter, mit anderen Soldatinnen und Soldaten zu sprechen, und für sie leichter, Soldatinnen und Soldaten zuzuhören als Menschenrechtsaktivistinnen und -aktivisten oder normalen Bürger*innen“.
A Farewell To Arms hat Telegram und YouTube Kanäle. Sie erzählen die Geschichten derjenigen, die aus der Armee desertiert sind, erklären, wie man desertiert, und schreiben Briefe an politische Gefangene: Denn wenn die Gefängnisse solche Briefe erhalten, ist das ein Zeichen, dass man sich an diese Gefangenen erinnert, und das macht es schwieriger, sie verschwinden zu lassen. „Zu Beginn des Krieges gab es in der russischen Armee nicht viele Leute, die wirklich und ideologisch bereit für diesen Konflikt waren. Nur sehr wenige glaubten der offiziellen Version, wonach die Ukraine von den Nazis befreit werden musste. Es gab diejenigen, die Befehle befolgten, aber in Wirklichkeit nicht mit der Ideologie übereinstimmten“. Und an diese Menschen richtet sich A Farewell To Arms. „Ja, wir verstoßen gegen das Gesetz, wir übernehmen die Verantwortung für unser Handeln: Es ist wichtig, dass in Russland bekannt wird, dass es Desertierende gibt, dass ein anderer Weg möglich ist“, erklärt Aleksandr.
Aleksandr sagt, dass jede Person, die mit ihnen Kontakt aufnimmt, natürlich aus Sicherheitsgründen überprüft wird. „Entlang der russisch-ukrainischen Frontlinien gibt es Lager, in denen Militärangehörige, die zu fliehen versuchen, festgehalten werden“, fügt er hinzu.
Ich finde dies in einer Analyse von Yuri Fedorov bestätigt, der die Aussage eines russischen Soldaten wiedergibt: „Die häufigste Maßnahme ist, sie in eine große Grube unter freiem Himmel zu stecken, wegen verschiedener ‚Vergehen‘: Alkoholkonsum, Konflikte mit Vorgesetzten, unerlaubtes Verlassen des Postens. Es kommt vor, dass eine Person in einen Keller geworfen wird, meist in einem verlassenen Gebäude, wie eine Schule oder ein Krankenhaus, weil sie sich weigert zu kämpfen. Dort wird sie gefoltert. Nach einem Monat in einer solchen ‚Zelle‘ unter unmenschlichen Bedingungen geht ein Mensch überall hin“.
Russischen Medienquellen zufolge ist die Zahl der russischen Militärangehörigen im Dezember 2024 auf rund 2,4 Millionen gestiegen, davon 1,5 Millionen Soldatinnen und Soldaten. Am 31. Mai 2024 teilte das britische Verteidigungsministerium mit, dass die Gesamtzahl der russischen Soldatinnen und Soldaten, die seit Kriegsbeginn getötet oder verwundet wurden, 500.000 beträgt. Verschiedene unabhängige Medien versuchen noch, diese Angaben zu überprüfen. Laut Fedorov könnte die Zahl zwischen 330.000 und 525.000 Personen liegen.
Allein im Jahr 2023 desertierten Fedorovs Angaben zufolge zwischen 30.000 und 40.000 Personen, wobei es sich allerdings um schwer zu verifizierende Daten handelt. Wie Regard sur l'Est, eine Zeitschrift, in der sich verschiedene Experten auf diesem Gebiet zusammengeschlossen haben, erklärt, haben die russischen Behörden im Jahr 2023 „angeblich die Beta-Version einer Datenbank von Personen eingeführt, die für den Militärdienst und/oder die Mobilisierung in Frage kommen. Dies würde es der Regierung ermöglichen, die Kontrollen zu verstärken und diejenigen, die sich ihrer Wehrpflicht entziehen wollen, am Grenzübertritt zu hindern (seit Beginn des Krieges sollen zwischen 500.000 und eine Million Menschen das Land verlassen haben)“.
In Wirklichkeit, so Colin-Lebedev, sei es wirklich schwierig, aktuelle Zahlen über Russland zu bekommen: „Das Problem, das wir mit der russischen Armee haben, ist, dass sie offizielle Daten herausgibt, die wenig mit der Realität zu tun haben. Das heißt, diese Zahl [von 1,5 Millionen Soldatinnen und Soldaten] ist in Wirklichkeit ein Ziel. So möchte sich die russische Armee selbst sehen“.
Ich frage, was die Aktionen von Aleksandr, Sergej und Georgij in wirtschaftlicher Hinsicht für sie bedeuten. Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, ist Aleksander von meiner Frage überrascht. „Es war nie eine Frage des Geldes, wir hatten nur zwei Möglichkeiten: Russland zu verlassen und am Leben zu bleiben, oder ins Gefängnis zu gehen. Und außerdem wird heute auch im Gefängnis rekrutiert. Was auch immer passiert, selbst als Inhaftierter landet man im Krieg.“
*Die Namen in diesem Artikel wurden geändert.
🤝 Dieser Artikel wurde im Rahmen des PULSE-Projekts veröffentlicht. Angelina Davydova von n-ost hat an seiner Herstellung mitgewirkt.
Schätzen Sie unsere Arbeit?
Dann helfen Sie uns, multilingualen europäischen Journalismus weiterhin frei zugänglich anbieten zu können. Ihre einmalige oder monatliche Spende garantiert die Unabhängigkeit unserer Redaktion. Danke!

















