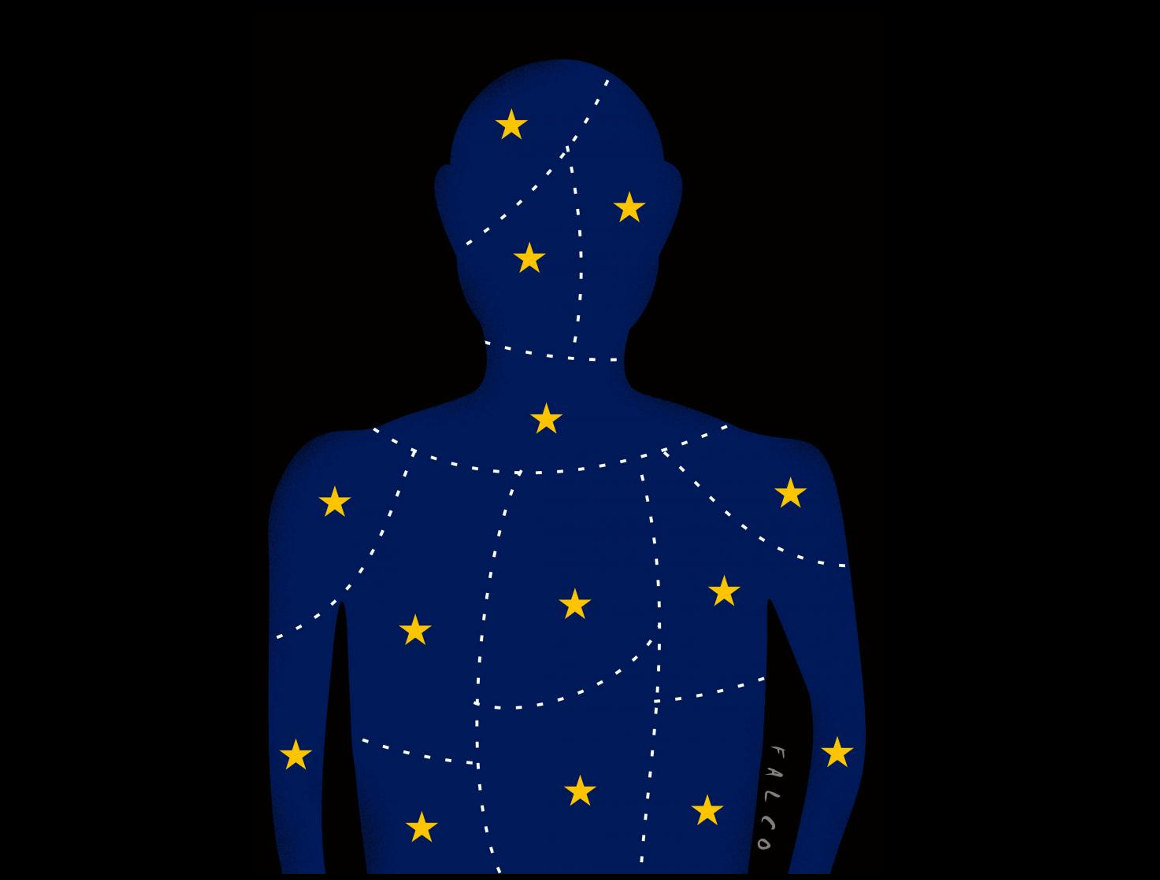„Wie kann man ein Land mit 246 verschiedenen Käsesorten regieren?“ soll Charles de Gaulle, der Gründungspräsident der Französischen Fünften Republik, gefragt haben. Während sich die Europäische Union auf die Europawahlen im nächsten Jahr vorbereitet, steht sie vor einer noch größeren Herausforderung: Wie soll man eine multinationale demokratische Gemeinschaft mit 24 Amtssprachen führen? Und wir dürfen nicht vergessen, dass sich die Union auf ein Jahrzehnt der Erweiterung vorbereitet, die möglicherweise die Ukraine, Moldawien und Georgien sowie sechs Länder des westlichen Balkans einbeziehen wird, wodurch die Zahl der Amtssprachen auf 30 steigen würde. In Europa insgesamt gibt es eine noch größere Vielfalt an Sprachen – nach Angaben eines Experten zwischen 64 und 234.
Das ist wichtig. Politik ist auch Theater. Politiker sind Schauspieler, wie wir auf der nationalen und internationalen ‚Bühne‘ beobachten können. Und in der Demokratie geht es darum, dass die Menschen miteinander reden. Was ist, wenn man kein Wort von dem versteht, was die anderen sagen?
Europa hat drei Antworten auf diese Frage: Mehrsprachigkeit, Übersetzung und die englische Sprache. Laut der offiziellen Website der EU ist die Mehrsprachigkeit ‚eines der Gründungsprinzipien der EU‘. Diese bunte sprachliche Vielfalt – ein Kontrast im Vergleich zu den USA – gehört zu den Dingen, die Europa so unendlich faszinierend machen.
Wer im Europäischen Parlament eine dieser 24 Sprachen spricht, wird vom besten Team von Fachübersetzern außerhalb der UNO in die anderen Sprachen gedolmetscht. „Die Sprache Europas ist die Übersetzung“, sagte der italienische Schriftsteller Umberto Eco. Aber mit der Politik verhält es sich wie mit der Poesie, sie geht ‚in der Übersetzung verloren‘. Es gibt Schlüsselwörter, Resonanzen, Assoziationen, Arten von Rhetorik, die die Emotionen berühren, die in jedem einzelnen Fall anders sind. Die Reden von Winston Churchill haben auf Slowenisch nicht dieselbe Kraft, ebenso wenig wie die von de Gaulle auf Deutsch.
Wenn Sie also ein breiteres Publikum erreichen wollen – und zwar sowohl die Herzen als auch die Köpfe – dann ist die einzige Lösung, in so vielen Sprachen wie möglich zu erscheinen. Deshalb bemühe ich mich, meine Kommentare in einer Vielzahl von europäischen Zeitungen und Zeitschriften zu veröffentlichen, und deshalb sind jetzt etwa zwanzig verschiedene europäische Ausgaben meiner persönlichen Geschichte Europas, Homelands, in Vorbereitung. Jede Ausgabe und die Debatte, die ich führe, wenn ich in das jeweilige Land reise, um darüber zu sprechen, offenbart subtile, aber tiefgreifende Unterschiede in der Art und Weise, wie diese Gesellschaft Europa erlebt – und gleichzeitig auch, wie diese Gesellschaft über sich selbst denkt.
Das fängt schon bei dem Wort ‚Homelands‘ an. Das Portugiesische Pátrias ist nicht ganz dasselbe wie das Estnische Kodumaad, während man im Deutschen ‚Heimat‘ überhaupt nicht im Plural verwenden kann.
Doch die meisten von uns können die Sprachen der anderen nicht sprechen, und niemand von uns ist in der Lage, alle Sprachen zu sprechen. Und als Normalsterbliche können wir uns auch keine Dolmetscher und Übersetzer leisten. (Die jährlichen Kosten für diese Dienste belaufen sich für die europäischen Institutionen auf etwa 1 Milliarde Euro).
Also müssen wir auf Englisch zurückgreifen. Oder sollte ich Euro-Englisch sagen? Denn obwohl ‚Englisch‘ als Amtssprache der EU aufgeführt ist, ist es seit dem Austritt Großbritanniens aus der EU nur noch in Irland und Malta als Amtssprache vertreten – neben Irisch und Maltesisch.
Englisch ist die mit Abstand am weitesten verbreitete Sprache, sowohl in der EU als auch in Europa insgesamt. Laut einer Studie aus dem Jahr 2012 sprachen etwa vier von zehn EU-Bürgern Englisch. (Das schließt die britischen Muttersprachler nicht ein, die in jenen fernen, glücklichen Tagen noch europäische Bürger waren). Der Anteil ist heute wahrscheinlich noch höher. Englisch ist also das, was Latein für Europa jahrhundertelang war, nur in noch stärkerem Maße, denn Latein war einer relativ kleinen Bildungselite vorbehalten.
Ich habe darüber nachgedacht, weil der Guardian diese Woche etwas tut, was ich mir schon lange gewünscht habe. Er bringt eine europäische digitale Ausgabe auf den Markt, die die drei bereits existierenden Ausgaben für die Anglosphäre – UK, USA und Australien – ergänzt.
Der Guardian hat bereits eine einzigartige Reichweite in Kontinentaleuropa – mehr als 250 Millionen Seitenaufrufe im vergangenen Jahr und fast 25 Millionen Besucher monatlich. Wenn diese 25 Millionen regelmäßigen Guardian-Leser einen Staat bilden würden, wäre dieser das an der Bevölkerung gemessen sechstgrößte Land in der EU.
Der Guardian baut seine Berichterstattung über Europa aus, stellt neue transkontinentale Reporter für die Bereiche Umwelt, Sport, Kultur und Gemeinschaftsangelegenheiten ein, holt einige großartige neue Kommentatoren vom ganzen Kontinent hinzu und startet einen europäischen Live-Blog. Dieser wird den bestehenden Ukraine-Live-Blog ergänzen, der seit Putins groß angelegter Invasion der Ukraine im vergangenen Februar in Europa die Zeit nach dem Fall der Mauer beendet hat. All dies wird eine nützliche Quelle für künftige Historiker dieser dramatischen und gefährlichen neuen Periode sein, wie auch immer sie letztendlich genannt werden wird.
Aber mit der Politik verhält es sich wie mit der Poesie, sie geht ‚in der Übersetzung verloren‘. Es gibt Schlüsselwörter, Resonanzen, Assoziationen, Arten von Rhetorik, die die Emotionen berühren, die in jedem einzelnen Fall anders sind
Natürlich ist der Guardian nicht allein in der englischsprachigen Eurosphäre. Die europäische Ausgabe von Politico leistet hervorragende Arbeit, ebenso wie Websites wie voxeurop.eu, euractiv.com und eurotopics.net. Die Financial Times ist eine ausgewählte Tribüne für Europas politische, diplomatische und wirtschaftliche Eliten. Die großen kontinentalen Zeitungen und Zeitschriften haben ihre eigenen englischsprachigen Websites.
Sowohl nach quantitativen als auch nach qualitativen Kriterien beurteilt wird der Guardian eindeutig ein wichtiger Akteur sein. In Gesprächen mit mir haben die Redakteure jedoch betont, dass sie nicht versuchen, die anderen zu verdrängen. Je mehr, desto besser. Und das ist der springende Punkt: Selbst wenn diese digitale europäische Ausgabe spektakulär gut abschneidet und sich in der Folge weitere große Player anschließen, wird ihre gemeinsame monatliche Leserschaft mit ziemlicher Sicherheit immer noch weit unter 10 Prozent der EU-Bevölkerung liegen. Der Anteil an der Gesamtbevölkerung Europas wird entsprechend noch viel kleiner sein.
Die europäische Öffentlichkeit wird also weiterhin dreidimensional sein: zahlreiche Einzelsprachen (unabhängig davon, ob sie Amtssprachen eines oder mehrerer Staaten sind oder nicht), die „Übersetzung“, auf die Umberto Eco verwies, und die englische Sprache.
Manch einer mag sich darüber beschweren – oder zumindest wundern –, dass eine Publikation mit Sitz im Post-Brexit-Großbritannien sich so entschlossen in die Euro-Sphäre begibt. Das ist töricht. Ein außergewöhnliches Zusammentreffen von Umständen in den späten 2010er Jahren ermöglichte es einer Gruppe geschickter politischer Unternehmer, Großbritannien aus der EU herauszunehmen. Man kann aber weder Großbritannien aus Europa noch Europa aus Großbritannien herausnehmen. Geografisch, historisch, kulturell und politisch ist Großbritannien immer dort gewesen und wird auch dort bleiben.
Wenn es nach dem Guardian ginge, hätte Großbritannien die EU ohnehin nie verlassen. Gerade weil Großbritannien nicht mehr institutionell in die politische Kerngemeinschaft Europas eingebettet ist, wird es umso wichtiger, jede andere Art von Verbindung über den Ärmelkanal hinweg zu intensivieren.
Schließen Sie sich mir also an, und begrüßen Sie diese großartige neue Ressource für die Eurosphäre – und die europäische Demokratie – mit Bienvenue, Willkommen und Vitajte.
---
Die deutsche Ausgabe von Timothy Garton Ashs Homelands, „Europa: Eine persönliche Geschichte“, ist im Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG erschienen. Weitere europäische Ausgaben sind in Vorbereitung.
👉 Originalartikel im Guardian
Schätzen Sie unsere Arbeit?
Dann helfen Sie uns, multilingualen europäischen Journalismus weiterhin frei zugänglich anbieten zu können. Ihre einmalige oder monatliche Spende garantiert die Unabhängigkeit unserer Redaktion. Danke!