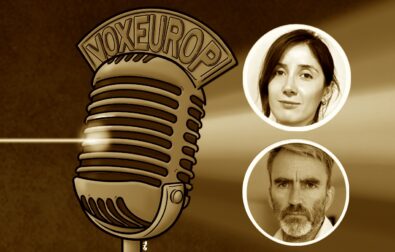Eines der Stereotypen in der europäischen Politik ist das "düstere" Bild des Balkans: das "Pulverfass" im Südosten, ein desolates Sortiment mit unvereinbaren Nationalismen, Intoleranz und Gewalt; Kosovo, Wirtschaftsschwund, Fundamentalismus usw. Alle Laster der Prämoderne, des Totalitarismus, des Anti-Europas konkurrieren hier scheinbar miteinander bei der Definition eines siechen Gebiets, das schleichend immer weiter in die Rippen der westlichen Zivilisation hineinwächst. Aus der Sicht der entwickelten Länder ist schwer zu sagen, was kostspieliger ist: sich die Mühe geben, eine rückständige Region wirtschaftlich zu integrieren und somit einer Involutionsgefahr vorzubeugen, oder sich aus der Region zurückziehen, dafür aber zu hohen militärischen Ausgaben gezwungen sein, um die aus dieser Abkehr herrührenden Krisen zu meistern.
Das Opferlamm der westlichen Zivilisation
Erbittert über eine solche Darstellung versuchen manche Balkanstaaten, sich von ihrer geographischen Lokalisierung loszulösen: Kroatien und Slowenien streben ein Hinübergleiten zur mitteleuropäischen Zugehörigkeit an. Rumänien, nördlich der Donau gelegen, verhält sich manchmal, vielleicht bis zu einem gewissen Grad auch zu Recht, als "Schiedsrichter" für das Gebiet und positioniert sich gleichzeitig als außenstehend. Andere Staaten, die kein gültiges Argument für ihre Nichtbalkanität vorbringen können, suchen ihre Rettung in der Errichtung einer Art Utopie des "Balkanwunders". An die Stelle des düsteren Bildes tritt somit ein euphorisches: der Balkan als Wiege Europas (und als Quelle seines von den Griechen erfundenen Namens), der Balkan als Salz und Pfeffer des Kontinents, der Balkan, aus dem Authentizität und Tradition geschöpft werden können. Als Anhaltspunkte, um ihn zu definieren, werden das antike Griechenland und Byzanz heraufbeschworen. Zu den großen gründerischen Tugenden kommt dann noch der Märtyrergedanke. Der Balkan ist der Leidtragende der westlichen Politik, das Opferlamm der undankbaren westlichen Zivilisation, die doch schließlich nur dank des "Festungswalls" im Osten möglich ist.
Wie soll die EU mit dem Balkan umgehen?
Der Stolz, dem Balkan anzugehören, ist jedoch kaum eine Lösung für die chronischen Spannungen, die sich tief in die Region hineingraben. Jedes Balkanland betrachtet sich als das "echte" Zentrum des Balkans. Dies verursacht einen grimmigen Kampf um die Führungsposition, einen Wahn der Einbildung auf seine jeweilige Leitkultur, der zwischen Pathos und Lächerlichkeit fluktuiert. Damit es noch ein bisschen komplizierter wird, kommt dazu das Bild, das sich die Europäische Union vom Balkan macht. Sie wäre gerne wohlwollend, gerecht, "politisch korrekt", doch beschränkt sich oft auf eine rein quantitative Analyse, auf Vorurteile und didaktische Ansätze. Brüssel hat weder die Zeit zu verstehen noch die Geduld zuzuhören. Es verfällt entweder in paternalistische Ergüsse ("Wir wissen besser als ihr, was gut für euch ist") oder in eine willfährige, kontraproduktive Höflichkeit ("Wir wollen euch nicht belehren, wir haben kein Recht, euch etwas aufzuerlegen"). Die erste Version stachelt den lokalen Stolz auf, die zweite bestärkt sterile Selbstgefälligkeit. Es lässt sich daraus folgern, dass es ebenso schwierig ist, anderen zu helfen, wie selbst Hilfe anzunehmen. Dem "Kern" Europas ist es noch nicht gelungen, das Balkanklischee, die abwertende Belastung einer geographischen Bezeichnung durch eine Reihe tieferer Erkenntnisse über die Region zu ersetzen. Wenn wir dieses Gebiet nur "retten" wollen, um uns vor eventuellen Komplikationen an den Grenzen Europas zu schützen, dann werden wir nie wissen, was wir nun eigentlich retten. Die Frage hieße also: Was macht die Länder dieser Region rettenswert und welche europäischen Werte würden durch das Scheitern einer willkürlichen Balkanpolitik verloren gehen? Ohne diese Perspektive bleibt der Balkan, wie jemand sagte, "eine Hölle, deren Weg mit den schlechten Vorsätzen der Großmächte gepflastert ist".
Bosnien und Herzegowina
Nasa Stranka, eine Partei für den multi-ethnischen Staat
Im Februar 2008 gründeten drei Intellektuelle – Danis Tanovic, Oscar-Preisträger von 2001 für seinen Film No Man’s Land, Theaterregisseur Dino Mustafic und Pedja Kojovic, ehemaliger Kameramann der Agentur Reuters – in Sarajevo die "multi-ethnische" politische Partei Nasa Stranka [Unsere Partei]. "In dem vom Vermächtnis des Krieges noch zerschmetterten Bosnien und Herzegowina, das durch Nationalismen gespalten und durch Korruption und Zukunftsängste unterhöhlt ist", prangern sie die "Plünderung" des Landes sowohl durch die muslimischen als auch durch die serbischen und kroatischen Nationalisten an und empören sich über die "Apathie der jungen Generationen", schreibtdie französische Tageszeitung Le Monde, die ihnen eine lange Reportage widmete.
Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 wurde die von Bojan Bajic geleitete Partei durch "noch weitere Aufständische aus Nichtregierungsorganisationen und Vereinen zur Verteidigung der Menschenrechte" ergänzt, die "dieselben antinationalistischen Überzeugungen und dieselbe Abscheu vor der das ganze Land verseuchenden Korruption teilen", heißt es weiter.
Bei den Stadtwahlen von 2008 heimste Nasa Stranka ihren ersten Erfolg ein: "Nicht nur wurde Ermin Hajder, ein muslimischer Bosniak, Bürgermeister von Bosanski Petrovac [im Westen des Landes, 5000 Einwohner], insbesondere durch die Stimmen der jungen Wähler und der serbischen Gemeinschaft im Ort, doch die entstehende Bewegung heimste auch genügend Sitze im Stadtrat von Sarajevo ein, wodurch die sozialdemokratische, ebenfalls multi-ethnische und pro-europäische SDP den muslimischen Nationalisten das Bürgermeisteramt der Hauptstadt entreißen konnte."
Für die kommenden Parlamentswahlen am 3. Oktober bildete die Partei in der Serbischen Republik "eine Koalition mit der einzigen serbischen antinationalistischen Bewegung, der Neuen Sozialistischen Partei (NSP) von Zdravko Krsmanovic, dem Bürgermeister von Foca". Nasa Stranka stellt zwar keinen Präsidentschaftskandidaten auf, hofft jedoch auf einen Einzug in die drei Parlamente (das von Bosnien-Herzegowina und die der beiden Gliedstaaten) sowie in die Kantonalräte. "In einem Land mit verzweifelten Bürgern und starker Wahlmüdigkeit (...) hofft Nasa Stranka auf ein Wunder, auf ein Aufbäumen", schließt Le Monde.
Schätzen Sie unsere Arbeit?
Dann helfen Sie uns, multilingualen europäischen Journalismus weiterhin frei zugänglich anbieten zu können. Ihre einmalige oder monatliche Spende garantiert die Unabhängigkeit unserer Redaktion. Danke!