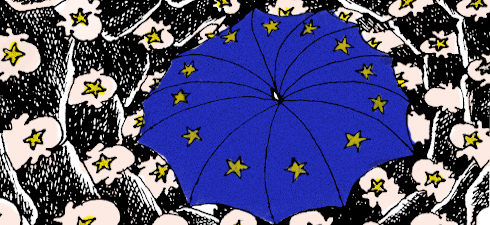Die Metapher vom fahrenden Zug ohne Bremsen. Das Gespenst von einem Europa mit nicht nur der Türkei, sondern auch der Ukraine, Georgien und noch weiter entfernten Ländern als Mitglieder. Unregierbar geworden durch Unterschiede in Kultur und wirtschaftlicher Entwicklung.
Die Angst wird noch durch die Tatsache genährt, dass es keine echte Ostgrenze gibt und die Erweiterung eine Herzensangelegenheit der Union zu sein scheint. Frieden, Sicherheit und Stabilität durch Integration. Nach 1989 wurde die Union um zwölf Staaten erweitert, auch wenn man wusste, dass einige Beitrittskadidaten noch nicht dafür bereit waren.
Manche sagen, der Zug ist abgefahren. Nicht nur, weil die Fakten belegen, dass die Erweiterung reine Politik ist, sondern auch, weil der Charakter der Union sich derart verändert hat, dass ein noch ein paar Länder mehr im Grunde auch nichts mehr ausmachen.
Und in der Tat: Es gibt noch vier Beitrittskandidaten, mit denen offiziell gesprochen wird (Kroatien, Mazedonien, Montenegro und Serbien), sowie zwei weitere Balkanstaaten, die in Frage kommen (Albanien und Bosnien-Herzegowina, wenn es nicht auseinanderfällt). Diese Staaten liegen praktisch in der Mitte Europas. „Außerdem“, sagt der belgische Politologe Hendrik Vos, „sollten diese Länder ihre Hausaufgaben machen, wie wir es von ihnen seit Jahren verlangen, dann können wir unmöglich sagen: Bleibt mal noch eine Weile vor der Tür.“
Jedes nationale Parlament hat ein Vetorecht
Es wird viel gestritten, ob Grenzen von Geografie, Demokratie, Politikern oder Wählern bestimmt werden. Die Antwort lautet: von allem. Und deshalb ist die Idee, dass die Union immer weiter auf Expansionskurs geht, auch nicht richtig.
Beginnen wir mit der Geografie. Es gibt vielleicht keine Ostgrenze, aber eine deutliche Südgrenze. In Sachen Demokratie bezieht man sich stets auf die Kopenhagener Kriterien: die Beitrittsanforderungen wie Rechtsstaat, faire Wahlen, Achtung der Menschenrechte und so etwas Vages wie die Zugehörigkeit zur „Wertegemeinschaft“.
Folglich heißen die Europhilen jene Länder in Europa willkommen, die bereit sind, diese Werte zu umarmen. Aber selbst für Josef Janning, Studienleiter beim European Policy Center und Befürworter der Erweiterung, bedeutet dies, dass beispielsweise Russland oder die Türkei nie beitreten werden. „Weil sie sich selbst als etwas Besonderes sehen und nicht unter fremden Regeln arbeiten wollen.“
Und dann die Politiker. „Man muss schauen, wo die Regierbarkeit aufhört, wie viele Gesetze man gemeinsam machen kann“, sagt Vos, der zwei Bücher über die Entscheidungsprozesse innerhalb der EU geschrieben hat. Die Grenze scheint erreicht. Darüber hinaus besitzt jedes nationale Parlament ein Vetorecht. Was bedeutet, dass die öffentliche Meinung letztlich die ultimative Bremse der Erweiterung sein kann. In vielen Ländern unterstützen die Menschen ein größeres Europa nicht länger. Die Zeiten, dass man den Beitritt mit Wirtschaftswachstum kaufen kann, sind vorbei.
Zum 4. Teil der Euromythen-Serie.
Schätzen Sie unsere Arbeit?
Dann helfen Sie uns, multilingualen europäischen Journalismus weiterhin frei zugänglich anbieten zu können. Ihre einmalige oder monatliche Spende garantiert die Unabhängigkeit unserer Redaktion. Danke!