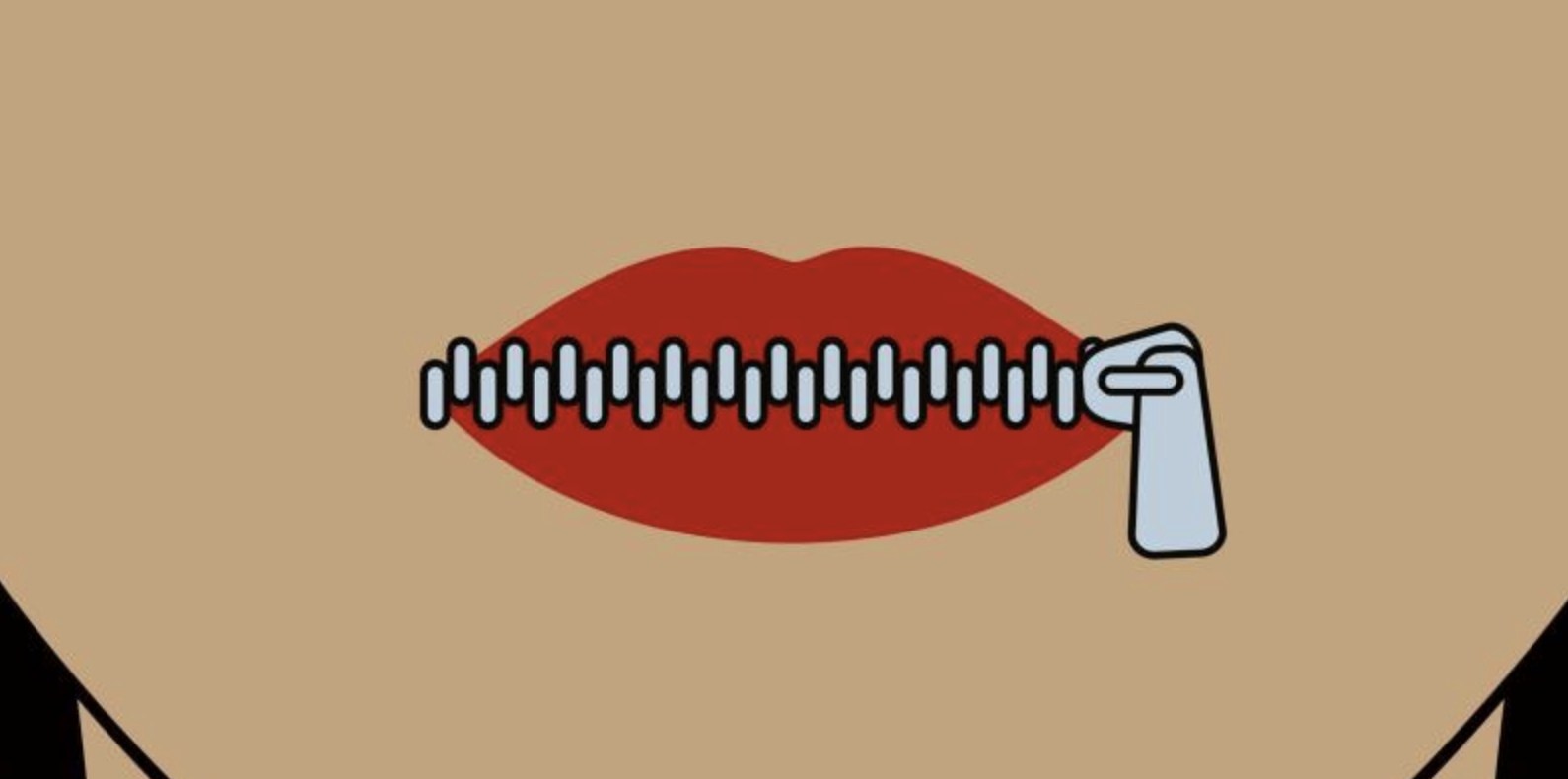Am 6. Februar 2024 erzielten das Europäische Parlament und der Europäische Rat eine Einigung über die im März 2022 vorgeschlagene EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Dieser Text soll eine Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten in Bezug auf sexuelle Belästigung, weibliche Genitalverstümmelung, Sterilisation, Zwangsheirat und „revenge porn“ („pornografische Rache“, die Verbreitung von Bildern mit sexuellem Inhalt mit dem Ziel, einer Person zu schaden) ermöglichen.
Artikel 5, der sich mit einer europäischen Definition von Vergewaltigung auf der Grundlage der fehlenden Zustimmung befasst, wurde gestrichen, da keine Einigung erzielt werden konnte. Aber trotzdem ist ihm die Eröffnung und Ausweitung einer Debatte über die Gesetzgebung zu Vergewaltigung und den Begriff der sexuellen Zustimmung in ganz Europa zu verdanken.
Seit dem Start der #MeToo-Bewegung im Jahr 2018, bei der eine Welle von Anzeigen von Tätern über soziale Netzwerke hereinbrach, ist der Begriff „Zustimmung“ in aller Munde. Er stammt ursprünglich aus dem juristischen Bereich und ist Gegenstand zahlreicher Debatten über seine genaue Implikation in einem sexuellen und sentimentalen Kontext.
Die Debatte über Artikel 5
Die Verabschiedung von Artikel 5 hätte eine Änderung der Gesetzestexte in allen Mitgliedsstaaten bedeutet, die nicht über eine auf Zustimmung basierende gesetzliche Definition von Vergewaltigung verfügen, wie Frankreich, Portugal, Italien oder auch Polen. Spanien, Schweden, Finnland, Slowenien, Dänemark und die Niederlande haben jedoch bereits den Schritt zu einer sogenannten „Nur Ja heißt Ja“-Gesetzgebung getan.
Die Entscheidung, diesen Artikel nicht aufzunehmen, war sehr knapp: Eine Änderung der Position Frankreichs oder Deutschlands hätte ausgereicht, um ihn zu verabschieden. Der offizielle Grund, der angeführt wurde? Vergewaltigung fällt nicht unter die „EU-Straftaten“, wie sie in Artikel 83 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU (AEUV) definiert sind.

Die Europäische Union hat die Istanbul-Konvention ratifiziert, die tatsächlich eine auf Zustimmung basierende Definition von Vergewaltigung auf der Grundlage des berühmten Artikels 5 festlegt. Die Konvention wurde auch von Deutschland und Frankreich unterzeichnet, aber Bulgarien, Ungarn, Lettland, Litauen, die Slowakei und Tschechien fehlen noch.
Laut der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) wurden 55 %, also mehr als die Hälfte der Frauen in der Europäischen Union, seit ihrem 15. Lebensjahr sexuell belästigt, und jede dritte Frau, also 33 %, hat körperliche und/oder sexuelle Gewalt erlitten.
Zwischen 2021 und 2023 wurden in Europa mehr als 68.000 Anzeigen wegen Vergewaltigung registriert. Das ergibt sich aus Daten, die vom Mediterranean Institute for Investigative Reporting (MIIR) im Rahmen einer Umfrage des European Data Journalism Network (EDJNet), an der Voxeurop beteiligt war, gesammelt wurden. Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe sind jedoch nach wie vor die Straftaten, die den Behörden am wenigsten gemeldet werden. In Irland werden nur 5 % der sexuellen Übergriffe angezeigt, so das Statistische Zentralamt.
Auch wenn inzwischen freier über das Thema gesprochen wird, sehen viele nun das Versagen unserer Systeme zur Unterstützung und Betreuung von Opfern, insbesondere auf gerichtlicher Ebene.
Warum sollte der Begriff „Zustimmung“ in das Gesetz aufgenommen werden?
Frédérique Pollet-Rouye, auf sexistische und sexuelle Gewalt spezialisierte Anwältin und Aktivistin, ist Mitverfasserin einer Stellungnahme, die im Dezember 2023 in Le Monde veröffentlicht wurde. Sie wurde von einem Kollektiv von Anwältinnen, Autorinnen und Richterinnen unterzeichnet und trägt den sehr expliziten Titel: „Sexuelle Gewalt: ‚Es ist dringend notwendig, die Vergewaltigung strafrechtlich neu zu definieren. Ihre Definition setzt in Frankreich eine stillschweigende Zustimmung voraus.‘“ Sie erklärt: „Nach geltendem Recht gilt eine sexuelle Handlung, die nachweislich nicht einvernehmlich ist, nicht als Vergewaltigung, wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass der Beschuldigte dem Opfer körperliche Gewalt angetan hat oder es überrascht, bedroht oder genötigt hat“.
Eine Gesetzesänderung sollte es ermöglichen, dass Vergewaltigungen, die heute nicht als solche gelten, von der Justiz aufgegriffen werden. Ein weiteres Ziel: Es soll nachgewiesenen Vergewaltigern erschwert werden, durch die Maschen des Netzes zu schlüpfen.
Der Begriff der Zustimmung bleibt also auch in den Gerichten von Rechtssystemen, deren Gesetzgebung auf Zwang und Gewalt basiert, ein zentrales Thema. Die Herausforderung besteht darin, den Begriff zu interpretieren oder ihn so zu gestalten, dass er den Opfern nicht zum Nachteil gereicht. Das ist der Punkt, an dem man sich einig werden muss.
Eine Debatte auch in der feministischen Szene
In Deutschland wurde am 29. Januar 2024 ein von über 100 Frauen aus Kultur, Wirtschaft und Politik unterzeichneter offener Brief an den Bundesjustizminister Marco Buschmann geschickt. Die Unterzeichnerinnen plädierten darin für die Annahme der Richtlinie in ihrer ursprünglichen Form.
In einem Gastbeitrag in Le Monde warnte die Philosophin und feministische Essayistin Manon Garcia im Dezember 2023 hingegen davor, das französische Vergewaltigungsgesetz auf eine Version umzustellen, die auf der Nichteinwilligung basiert: „Es ist ein Fehler – ein sexistischer Fehler! – eine Vergewaltigung durch Nicht-Zustimmung zu definieren“, schreibt sie.
In Spanien, einem Land, das sich für ein sogenanntes „Nur Ja heißt Ja“-Gesetz entschieden hat, ist es die feministische Vordenkerin Clara Serra , die auf den Seiten von El Diario die Stichhaltigkeit einer solchen gesetzlichen Definition von Vergewaltigung in Frage stellt. Sie ist der Meinung, dass wenn man davon ausgeht, dass eine Frau aufgrund von Dominanzdynamiken ihre Ablehnung nicht ausdrücken kann, man die gleiche Argumentation auf eine Frau anwenden sollte, die ausdrücklich „Ja“ sagt. Ihre Zustimmung könnte nämlich genauso gut ein reines Produkt derselben Machtdynamiken sein.
Jana Kujundžić, eine auf sexistische Gewalt spezialisierte Forscherin, fasst zusammen: „Ich denke, dass eine positive Änderung des Vergewaltigungsgesetzes ein zeitgemäßes und evidenzbasiertes Verständnis von Vergewaltigung und sexueller Gewalt als soziales Problem hervorheben muss“.
Die Europaabgeordnete und Berichterstatterin des Textes Ervin Incir (Progressive Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament, S&D, wiedergewählt bei der letzten Europawahl) meint sogar, dass die Richtlinie „den nötigen Druck erzeugen könnte, damit die nationalen Regierungen ihre rechtlichen Definitionen aktualisieren, um sich an internationale Menschenrechtsstandards, wie sie in der Istanbul-Konvention festgelegt sind, anzupassen. In Zukunft erwarten wir, dass die Europäische Kommission aufbauend auf diesen Fortschritten neue Rechtsvorschriften vorschlagen wird, die sich speziell mit Vergewaltigung befassen.“
Ein kleiner Hoffnungsschimmer, den auch die irische Europaabgeordnete und zweite Berichterstatterin Frances Fitzgerald (Europäische Volkspartei, Mitte-Rechts, nicht wiedergewählt) betont: „Wenn es um sexuelle Beziehungen geht, muss das Einverständnis im Mittelpunkt des Gesprächs stehen. (...) Ich glaube, dass diese Richtlinie einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie wir über die Gesellschaft denken, herbeiführen kann – indem sie eine Wirkung über das reine Strafrecht hinaus schafft“.
Schätzen Sie unsere Arbeit?
Dann helfen Sie uns, multilingualen europäischen Journalismus weiterhin frei zugänglich anbieten zu können. Ihre einmalige oder monatliche Spende garantiert die Unabhängigkeit unserer Redaktion. Danke!