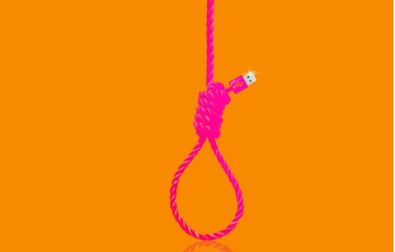Es war einmal eine Zeit, da kolonisierte Europa Teile von China. Heute kolonisiert China Teile von Europa. Ganz informell natürlich, und auf eine viel höflicher Art und Weise als damals, bevor der Spieß umgedreht wurde. Chinas Aufstieg wirft ein Licht auf Europas relativen Niedergang und nutzt ihn zugleich aus.
Wenn der chinesische Premier Wen Jiabao diese Woche nach Europa kommt, wird er Deutschland, Großbritannien und Ungarn besuchen. Warum Ungarn? Zum einen, weil es derzeit den Vorsitz der EU innehat, aber auch, weil China dort bedeutende Investitionen vorgenommen hat und noch einige mehr ansteuert – wie auch in anderen süd- und südosteuropäischen Staaten. Eine in Kürze erscheinende Untersuchung des European Council on Foreign Relations (ECFR) schätzt, dass 40 Prozent der chinesischen Investitionen in der EU sich in Portugal, Spanien, Italien, Griechenland und Osteuropa befinden.
Warum den Peripherieländern so viel Aufmerksamkeit zuwenden? Nun, dort sind vielversprechende Investitionen zu tätigen, und die kleineren Randstaaten sind ein einfacher Einstieg in einen europäischen Binnenmarkt mit 500 Millionen Verbrauchern. Der EU-Markt ist für chinesische Investoren weit offener als der chinesische Markt für Europäer.
„Ihr braucht unser Geld.“
Hohe Investitionen in diesen Ländern zahlen sich auch in politischer Hinsicht aus. Das ist nicht zu zynisch gedacht, kann man Peking doch dabei zusehen, wie es eine Art China-Lobby innerhalb der Entscheidungsorgane der EU aufbaut, wo auch der kleinste Staat zumindest theoretisch mit dem größten gleichgestellt ist.
China besitzt die größten Devisenreserven der Welt – derzeit rund drei Billionen Euro – und könnte damit auf der Stelle die Hälfte von Griechenlands privatisierbaren öffentlichen Gütern kaufen. Sollten sich die Griechen vor Danaergeschenken der Chinesen hüten? Tja, in der Not schmeckt jedes Brot. Wie ein renommierter chinesischer Geostratege mit ausgesuchtem Feingefühl zu einem der Autoren des bald erscheinenden ECFR-Berichts sagte: „Ihr braucht unser Geld.“
Man darf es diesbezüglich mit der Paranoia nicht übertreiben. Wenn wir an freien Handel und freie Märkte glauben, dann müssen wir auch unseren eigenen Predigten folgen. Es besteht allerdings kein Zweifel daran, dass die wirtschaftliche Macht Chinas bereits tief nach Europa eingedrungen ist – und sich in politischem Einfluss umsetzt.
Für manche von Chinas asiatischen Nachbarn war Chinas Aufstieg mit einer viel ausgeprägteren Kompromisslosigkeit verbunden. Während einige in Europa immer noch von geteilter Hoheitsgewalt in einer postmodernen Welt träumen, in welcher die EU zum Vorbild für die globale Regierungsform wird, erinnern die geopolitischen Verhältnisse in Asien zunehmend an diejenigen im Europa des späten 19. – und nicht etwa des späten 20. – Jahrhunderts. Unstete unabhängige Mächte wetteifern um die Vormachtstellung, bauen Flotten und Armeen auf und beanspruchen die Herrschaft über Land (wie etwa Kaschmir) und Meer. Nationale Interessen und Leidenschaften stehen über der gegenseitigen wirtschaftlichen Abhängigkeit.
Von Hegemonie und „humaner Autorität“
Neben der wirtschaftlichen und der militärischen Dimension der aufsteigenden Macht Chinas gibt es noch eine dritte Dimension: die politische, kulturelle oder „sanfte“ Gewalt. Yan Xuetong, einer von Chinas führenden Autoren über internationale Beziehungen, veröffentlichte kürzlich ein faszinierendes neues Buch namens Ancient Chinese Thought, Modern Chinese Power (dt.: Alte chinesische Denkweise, moderne chinesische Macht). Er erforscht darin die Lehren des politischen Denkens vor der Zeit der Qin-Dynastie – also vor 221 v. Chr. – und ihre Anwendung auf Chinas Rolle in der heutigen Welt.
Yan Xuetong ist der Meinung, man könne bei den alten chinesischen Denkern zwei kontrastierende Auffassungen von Staatsmacht unterscheiden: die Hegemonie und das, was sie die „humane Autorität“ nannten. Bei der „humanen Autorität“ stellen die Weisheit, die Tugendhaftigkeit und das wohltätige Wirken der Herrscher nicht nur deren eigenes Volk zufrieden, sondern üben auch eine Anziehungskraft auf andere aus, wodurch sich diese Vorgehensweise über die Landesgrenzen hinaus verbreitet.
Obwohl er auch der simplen Hegemonie nicht vollends abgeneigt zu sein scheint, spricht sich Yan Xuetong dafür aus, dass China diese ambitioniertere Art der politischen Macht anstreben soll – unter anderem durch „konstantes Erneuern des politischen Systems“. Trotz einer an dieser Stelle etwas elliptischen Wortwahl schlägt er auch vor, China solle „das moralische Prinzip der Demokratie zu einem der von ihm geförderten machen“.
Äußerer Einfluss auf die aufsteigende Weltmacht?
Das China von 2011 ist, muss man schon sagen, von einer solchen „humanen Autorität“ weit entfernt. Angefangen beim großen Erneuerer Deng Xiaoping, kann es einen moralischen Anspruch darauf erheben, Hunderte Millionen von Menschen aus der Armut emporgehoben zu haben. In den Augen der Entwicklungsländer auf der ganzen Welt ist sein Modell des staatlich verwalteten Kapitalismus eine ideologische Herausforderung an das heute krisengeschüttelte Modell des liberalen Kapitalismus mit freier Marktwirtschaft. In dem nun nach Europa reisenden Wen Jiabao besitzt es einen wirklich attraktiven, überlegten zweiten Mann, der bemerkenswert offen über die kritischen Fragen der Ausländer zu diskutieren bereit ist und sogar bei höchst kritischen jungen Chinesen in seiner Heimat gut ankommt.
Doch in den letzten Jahren fiel eine nervöse kommunistische Partei in ihrem Hochlauf bis zum für 2012 angesetzten Wechsel in der Parteiführung in eine Regierungsform zurück, die alles andere als human ist – von der Behandlung der ethnischen Minderheiten im Land bis zur Inhaftierung des Künstlers Ai Weiwei. Ihre Reaktion auf das Schreckgespenst des Arabischen Frühlings war im Vergleich zu den Einschätzungen der meisten Beobachter unverhältnismäßig besorgt.
Keines der drei Gesichter der chinesischen Macht – Wirtschaft, Militär und Politik – ist von den anderen trennbar. Alle sind dabei, sich zu verändern. Ein entscheidendes Engagement, so wie David Cameron und Angela Merkel es sich vom bewundernswerten Wen Jiabao erhoffen, ist erstrebenswert. Die harte Wahrheit jedoch lautet, dass sich der Einfluss Außenstehender auf die Entwicklung dieser aufsteigenden Supermacht in Grenzen halten wird. Wir müssen also unsere eigenen Angelegenheiten in Ordnung bringen, nah dranbleiben, und hoffen.
Aus dem Englischen von Patricia Lux-Martel
Schuldenkrise
Pekings Milliarden sind unbezahlbar
„Vor gar nicht so langer Zeit war der Besuch eines chinesischen Premierministers gleichbedeutend mit Protesten und mit Diskussionen über die Menschenrechte und die Repression in Tibet“, ist in El País zu lesen. Doch, wie die spanische Tageszeitung feststellt, „heutzutage wird die Anwesenheit von Wen Jiabao in Ungarn, Großbritannien und Deutschland praktisch nur noch durch das Prisma der Bedeutung des asiatischen Riesen für die europäische Wirtschaft betrachtet. Und der Gast hat sich sogar erlaubt, seinen Gastgebern eine Strafpredigt zu halten: über die Risiken, mit Waffengewalt den Frieden in Libyen durchsetzen zu wollen. Die Chinesen hatten vorsorglich mehrere Dissidenten, darunter den Künstler Ai Weiwei am Vortag des Besuchs freigelassen“.
„Als Wen Jiabao 2009 zum letzten Mal auf Staatsbesuch in Großbritannien war und an der Universität Cambridge einen Vortrag hielt, warf ein junger Mann einen Schuh nach ihm. Heute, zwei Jahre und eine Krise später, hat der Premier in Budapest versprochen, China werde Europa nicht im Stich lassen, ist durch eine chinesische Autofabrik in Birmingham spaziert als wäre er dort zuhause und dürfte heute am 28. Juni mit Angela Merkel über den Ärger mit dem Euro diskutieren. Und das alles gekrönt von Verträgen im Wert von ein paar Milliarden Euro“.
Dass Peking die Schuldentitel der Euro-Mitgliedsstaaten in Schwierigkeiten übernimmt, wie Spanien, Irland, Portugal und Griechenland, und nach Technologie hungert, das erweckt die Sympathie und den Geschäftssinn Europas, so El País weiter. Deshalb, heißt es abschließend, sei Europa „hocherfreut“, Peking zu helfen. „Selbst wenn es sich dabei die Nase zuhalten und falls nötig abkehren muss. Das nennt man Pragmatismus, und das gibt es schon immer.“